Abruf und Rang:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang: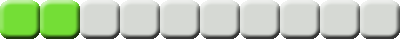 52% (656)
52% (656)
Zitiert durch:
BVerfGE 168, 1 - Beteiligungsidentische Schwesterpersonengesellschaften
BVerfGE 166, 359 - Wiederaufnahme
BVerfGE 165, 103 - Vororganschaftliche Mehrabführungen
BVerfGE 160, 284 - Verbotene Kraftfahrzeugrennen
BVerfGE 159, 149 - Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuerguthaben
BVerfGE 157, 177 - Vorausgezahlte Erbbauzinsen
BVerfGE 156, 354 - Vermögensabschöpfung
BVerfGE 155, 238 - Windseegesetz
BVerfGE 152, 274 - Erstausbildungskosten
BVerfGE 145, 171 - Kernbrennstoffsteuergesetz
BVerfGE 143, 246 - Atomausstieg
BVerfGE 142, 313 - Zwangsbehandlung
BVerfGE 141, 1 - Völkerrechtsdurchbrechung
Zitiert selbst:
BVerfGE 133, 1 - Verzinsung von Kartellgeldbußen
BVerfGE 132, 302 - Rückwirkung Gewerbesteuergesetz
BVerfGE 128, 193 - Dreiteilungsmethode
BVerfGE 127, 61 - Beteiligungsquote
BVerfGE 127, 31 - Entgangene Einnahmen
BVerfGE 127, 1 - Spekulationsfrist
BVerfGE 123, 186 - GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
BVerfGE 114, 258 - Versorgungsänderungsgesetz
BVerfGE 113, 88 - Elternunterhalt
BVerfGE 111, 54 - Rechenschaftsbericht
BVerfGE 110, 412 - Teilkindergeld
BVerfGE 105, 61 - Wehrpflicht I
BVerfGE 105, 48 - Entscheidungserheblichkeit
BVerfGE 105, 17 - Sozialpfandbriefe
BVerfGE 101, 239 - Stichtagsregelung
BVerfGE 98, 145 - Inkompatibilität/Vorstandstätigkeit
BVerfGE 97, 67 - Schiffbauverträge
BVerfGE 95, 64 - Mietpreisbindung
BVerfGE 88, 384 - Zinsanpassungsgesetz
BVerfGE 80, 244 - Vereinsverbot
BVerfGE 74, 129 - Widerruf von Leistungen
BVerfGE 72, 200 - Einkommensteuerrecht
BVerfGE 69, 315 - Brokdorf
BVerfGE 65, 196 - Unterstützungskasse
BVerfGE 63, 343 - Rechtshilfevertrag
BVerfGE 59, 128 - Bekenntnis zum deutschen Volkstum
BVerfGE 49, 304 - Sachverständigenhaftung
BVerfGE 45, 142 - Rückwirkende Verordnungen
BVerfGE 31, 113 - Jugendgefährdende Schriften
BVerfGE 30, 367 - Bundesentschädigungsgesetz
BVerfGE 30, 272 - Doppelbesteuerung Schweiz
BVerfGE 24, 220 - Angestelltenversicherung
BVerfGE 18, 429 - Verschollenheitsrente
BVerfGE 18, 85 - Spezifisches Verfassungsrecht
BVerfGE 13, 274 - Steuererhöhung im Veranlagungszeitraum
BVerfGE 13, 261 - Rückwirkende Steuern
BVerfGE 11, 139 - Kostenrechtsnovelle
BVerfGE 2, 181 - Besatzungsanordnungen
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang:
Zitiert durch:
BVerfGE 168, 1 - Beteiligungsidentische Schwesterpersonengesellschaften
BVerfGE 166, 359 - Wiederaufnahme
BVerfGE 165, 103 - Vororganschaftliche Mehrabführungen
BVerfGE 160, 284 - Verbotene Kraftfahrzeugrennen
BVerfGE 159, 149 - Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuerguthaben
BVerfGE 157, 177 - Vorausgezahlte Erbbauzinsen
BVerfGE 156, 354 - Vermögensabschöpfung
BVerfGE 155, 238 - Windseegesetz
BVerfGE 152, 274 - Erstausbildungskosten
BVerfGE 145, 171 - Kernbrennstoffsteuergesetz
BVerfGE 143, 246 - Atomausstieg
BVerfGE 142, 313 - Zwangsbehandlung
BVerfGE 141, 1 - Völkerrechtsdurchbrechung
Zitiert selbst:
BVerfGE 133, 1 - Verzinsung von Kartellgeldbußen
BVerfGE 132, 302 - Rückwirkung Gewerbesteuergesetz
BVerfGE 128, 193 - Dreiteilungsmethode
BVerfGE 127, 61 - Beteiligungsquote
BVerfGE 127, 31 - Entgangene Einnahmen
BVerfGE 127, 1 - Spekulationsfrist
BVerfGE 123, 186 - GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
BVerfGE 114, 258 - Versorgungsänderungsgesetz
BVerfGE 113, 88 - Elternunterhalt
BVerfGE 111, 54 - Rechenschaftsbericht
BVerfGE 110, 412 - Teilkindergeld
BVerfGE 105, 61 - Wehrpflicht I
BVerfGE 105, 48 - Entscheidungserheblichkeit
BVerfGE 105, 17 - Sozialpfandbriefe
BVerfGE 101, 239 - Stichtagsregelung
BVerfGE 98, 145 - Inkompatibilität/Vorstandstätigkeit
BVerfGE 97, 67 - Schiffbauverträge
BVerfGE 95, 64 - Mietpreisbindung
BVerfGE 88, 384 - Zinsanpassungsgesetz
BVerfGE 80, 244 - Vereinsverbot
BVerfGE 74, 129 - Widerruf von Leistungen
BVerfGE 72, 200 - Einkommensteuerrecht
BVerfGE 69, 315 - Brokdorf
BVerfGE 65, 196 - Unterstützungskasse
BVerfGE 63, 343 - Rechtshilfevertrag
BVerfGE 59, 128 - Bekenntnis zum deutschen Volkstum
BVerfGE 49, 304 - Sachverständigenhaftung
BVerfGE 45, 142 - Rückwirkende Verordnungen
BVerfGE 31, 113 - Jugendgefährdende Schriften
BVerfGE 30, 367 - Bundesentschädigungsgesetz
BVerfGE 30, 272 - Doppelbesteuerung Schweiz
BVerfGE 24, 220 - Angestelltenversicherung
BVerfGE 18, 429 - Verschollenheitsrente
BVerfGE 18, 85 - Spezifisches Verfassungsrecht
BVerfGE 13, 274 - Steuererhöhung im Veranlagungszeitraum
BVerfGE 13, 261 - Rückwirkende Steuern
BVerfGE 11, 139 - Kostenrechtsnovelle
BVerfGE 2, 181 - Besatzungsanordnungen
2. Eine nachträgliche, klärende Feststellung des geltenden Rechts durch den Gesetzgeber ist grundsätzlich als konstitutiv rückwirkende Regelung anzusehen, wenn dadurch eine in der Fachgerichtsbarkeit offene Auslegungsfrage entschieden wird oder eine davon abweichende Auslegung ausgeschlossen werden soll.
| |
Beschluss | |
des Ersten Senats vom 17. Dezember 2013
| |
| – 1 BvL 5/08 – | |
in dem Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung, ob der durch das Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz vom 22. Dezember 2003 (BGBl I S. 2840) angefügte § 43 Abs. 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) insoweit gegen das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3, Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes) verstößt, als darin die rückwirkende Anwendung des gleichzeitig angefügten § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG auf alle noch nicht bestandskräftigen Steuerfestsetzungen angeordnet worden ist, und dies zur Folge hat, dass Teilwertabschreibungen auf Anteile an Aktienfonds den steuerlichen Gewinn auch des Veranlagungszeitraums 2002 nicht mehr mindern durften – Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Münster vom 22. Februar 2008 – 9 K 5096/07 K –.
| |
Entscheidungsformel: | |
§ 43 Absatz 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften verstößt gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes aus Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes und ist nichtig, soweit danach § 40a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften auf Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit Anteilscheinen an einem Wertpapier-Sondervermögen stehen, rückwirkend bereits in den Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 anzuwenden ist.
| |
Gründe: | |
Die Vorlage betrifft die Frage, ob § 43 Abs. 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) insofern gegen das | |
A. – I. | |
1. Das Recht der inländischen Investmentgesellschaften war bis zum 31. Dezember 2003 im Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften geregelt. Die ursprüngliche Fassung dieses Gesetzes datiert vom 16. April 1957 (BGBl I S. 378). Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften enthielt die aufsichts- und steuerrechtlichen Vorschriften für inländische Kapitalanlagegesellschaften. Die entsprechenden Vorschriften für ausländische Kapitalanlagegesellschaften waren in dem ebenfalls zum Jahresende 2003 ausgelaufenen Auslandinvestment-Gesetz (AuslInvG) – ursprünglich in der Fassung vom 28. Juli 1969 (BGBl I S. 986) – enthalten.
| |
Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften und das Auslandinvestment-Gesetz wurden im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Investmentwesens und zur Besteuerung von Investmentvermögen (Investmentmodernisierungsgesetz) vom 15. Dezember 2003 (BGBl I S. 2676) mit Wirkung vom 1. Januar 2004 durch das Investmentgesetz (InvG) für das Aufsichtsrecht und das Investmentsteuergesetz (InvStG) für das Steuerrecht abgelöst. Das Investmentgesetz wurde inzwischen durch das am 22. Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ersetzt (BGBl I S. 1981), das Investmentsteuergesetz besteht fort.
| |
Die Vorlage betrifft die Endphase der zeitlichen Anwendung des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften. In dem Gesetzgebungsverfahren zum Investmentmodernisierungsgesetz setzte sich der Gesetzgeber unter anderem mit einem Auslegungsproblem zur ertragsteuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit von Teilwertabschreibungen auseinander (vgl. § 8 InvStG). Es ging um die | |
2. Hintergrund der Einführung des § 40a Abs. 1 KAGG war der Systemwechsel im Körperschaftsteuerrecht vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren (später Teileinkünfteverfahren). Dieser Systemwechsel (vgl. dazu BVerfGE 125, 1; 127, 224) hatte zu Änderungen des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften und des Auslandinvestment-Gesetzes geführt (vgl. BTDrucks 14/2683, S. 132). An den durch das Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (Steuersenkungsgesetz – StSenkG) vom 23. Oktober 2000 (BGBl I S. 1433) eingeführten, zunächst nur aus einem Satz bestehenden § 40a Abs. 1 KAGG a.F. wurde durch das Korb II-Gesetz vom 22. Dezember 2003 ein zweiter Satz (im nachfolgenden Text in Fett | |
§ 40a KAGG in der hier maßgeblichen Fassung des Korb II-Gesetzes lautet:
| |
§ 40a KAGG
| |
Die zeitliche Anwendung des § 40a Abs. 1 KAGG wurde durch das Korb II-Gesetz in § 43 Abs. 18 KAGG wie folgt festgelegt:
| |
§ 43 KAGG
| |
Nach der Begründung des Regierungsentwurfs (vgl. BTDrucks 15/1518, S. 17) handelt es sich bei § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG um eine "redaktionelle Klarstellung, dass § 8b Abs. 3 KStG auch bei Investmentanteilen gilt, wenn Verluste aus der Veräußerung der Anteilscheine oder Teilwertminderungen auf Wertminderungen der in dem Wertpapier-Sondervermögen befindlichen Beteiligungen beruhen". | |
Höchstrichterliche Rechtsprechung zur Auslegung des einfachen Rechts in dieser Frage liegt noch nicht vor. Beim Bundesfinanzhof sind zwei Revisionsverfahren hierzu anhängig (I R 33/09 und I R 74/12). Beide beziehen sich auf das Jahr 2002, welches auch das Streitjahr in dem Ausgangsverfahren der hier zu behandelnden Vorlage ist. Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu dem § 40a Abs. 1 KAGG a.F. betreffenden Auslegungsproblem ist noch nicht ergangen (vgl. Beschluss vom 15. Mai 2013 zur Aussetzung des Revisionsverfahrens I R 74/12, BFH/NV 2013, S. 1452).
| |
3. Nach dem um den Satz 2 ergänzten § 40a Abs. 1 KAGG bleiben Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit Anteilscheinen einer Kapitalgesellschaft an einem Wertpapier-Sondervermögen stehen, bei der steuerlichen Gewinnermittlung unberücksichtigt. Im Gegensatz zur vorherigen Fassung enthält § 40a Abs. 1 KAGG neben der ausdrücklichen Verweisung auf § 8b Abs. 2 KStG durch den neuen Satz 2 nunmehr auch eine ausdrückliche Verweisung auf § 8b Abs. 3 KStG.
| |
§ 8b KStG in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des Körperschaftsteuergesetzes vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4144, nachfolgend als KStG a.F. bezeichnet) lautet auszugsweise: | |
(1) ... (2) Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes gehören, oder an einer Organgesellschaft im Sinne der §§ 14, 17 oder 18, aus der Auflösung oder der Herabsetzung des Nennkapitals oder aus dem Ansatz des in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten Werts sowie Gewinne im Sinne des § 21 Abs. 2 des Umwandlungssteuergesetzes außer Ansatz. Das gilt nicht, soweit der Anteil in früheren Jahren steuerwirksam auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben und die Gewinnminderung nicht durch den Ansatz eines höheren Werts ausgeglichen worden ist. Veräußerung im vorstehenden Sinne ist auch die verdeckte Einlage. (3) Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit dem in Absatz 2 genannten Anteil entstehen, sind bei der Gewinnermittlung nicht zu berücksichtigen. (4) bis (7) ... | |
§ 8 Abs. 3 KStG a.F. ("bei der Gewinnermittlung") ist mit § 8b Abs. 3 Satz 3 der aktuellen Fassung des KStG ("bei der Ermittlung des Einkommens") nahezu wortgleich. Bei dem steuerlichen Begriff des Teilwerts handelt es sich nach der Legaldefinition in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) um den Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde, wobei davon auszugehen ist, dass der Erwerber den Betrieb fortführt (vgl. die Legaldefinition in § 10 Bewertungsgesetz). Sinkt der Teilwert im Vergleich zu den Anschaffungskosten, den Herstellungskosten oder zu dem Restbuchwert eines Wirtschaftsguts, kann eine Verpflichtung zur Teilwertabschreibung bestehen (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG; vgl. zum Handelsrecht § 253 HGB). Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert mindern grundsätzlich das zu versteuernde Einkommen. In den Fällen des § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG (§ 8b Abs. 3 KStG a.F.) gilt das jedoch ausnahmsweise nicht; hie | |
Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Anteilscheinen an einem Wertpapier-Sondervermögen (vgl. § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG), können – wie im Ausgangsverfahren des Finanzgerichts – bei im Wert gefallenen Anteilen an Aktienfonds vorliegen. Die Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG a.F. hat zur Folge, dass diesbezügliche Teilwertabschreibungen – zum Beispiel infolge von Kursstürzen an der Börse – bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens einer Körperschaft nicht berücksichtigt werden.
| |
II.
| |
Das Ausgangsverfahren betrifft die Körperschaftsteuer des Veranlagungszeitraums 2002 der dortigen Klägerin. Sie ist ein Kreditinstitut, das am 31. Dezember 2002 (Stichtag des Jahresabschlusses) in seinem Umlaufvermögen Anteile an zwei Investmentfonds hielt. Zum 31. Dezember 2002 waren die Börsenkurse der Anteilscheine an diesen Fonds unter die jeweiligen im Jahresabschluss des Vorjahres ausgewiesenen Buchwerte gesunken.
| |
Die klagende Bank nahm in ihrer am 14. Januar 2003 erstellten Handelsbilanz für das Jahr 2002 Abschreibungen auf die Fonds in Höhe von insgesamt 392.643,53 € vor. In seinem Lagebericht beschrieb der Vorstand den "stärksten Kurseinbruch in der Geschichte des DAX". Für den deutschen Aktienindex (DAX) sei das Jahr 2002 das dritte Verlustjahr in Folge gewesen. Nachdem der Index bereits in den Jahren 2000 und 2001 um 8% beziehungs | |
In der am 10. Juli 2003 erstellten Steuerbilanz für das Jahr 2002 führten die Abschreibungen auf die Fondsanteile, nachdem deren Kurswerte bis zur Erstellung der Steuerbilanz wieder gestiegen waren, zu einer Gewinnminderung in Höhe von 357.493,73 €. Die Klägerin wurde gemäß ihrer im August 2003 beim Finanzamt eingereichten Körperschaftsteuererklärung veranlagt. Die Körperschaftsteuer laut dem ursprünglichen Bescheid vom 22. Oktober 2003 betrug 95.509 €.
| |
Nach der Verabschiedung des Korb II-Gesetzes reichte die Klägerin Ende Februar 2004 beim Finanzamt eine geänderte Körperschaftsteuererklärung für das Jahr 2002 ein. Unter anderem erhöhte sie den bislang erklärten Gewinn um die für das Jahr 2002 vorgenommenen, als steuerwirksam behandelten Teilwertabschreibungen. Gleichzeitig kündigte die Klägerin einen Einspruch an, den sie sodann nach Erlass des Änderungsbescheids vom 27. April 2004 einlegte.
| |
Im Rahmen einer während des Einspruchsverfahrens durchgeführten Betriebsprüfung teilte der Prüfer unter Hinweis auf das Korb II-Gesetz die Auffassung der Finanzverwaltung, dass eine steuerliche Berücksichtigung der Teilwertabschreibung gemäß § 8b Abs. 3 KStG a.F. ausgeschlossen und der Gewinn daher entsprechend zu erhöhen sei. Unter Berücksichtigung der sich erhöhenden Gewerbesteuer-Rückstellung ergab sich im Hinblick auf die im Streit stehende Teilwertabschreibung für 2002 eine Gewinnerhöhung um einen Betrag von 282.019,50 €, die in dieser Höhe dem Körperschaftsteuer-Änderungsbescheid vom 13. April 2005 zugrunde gelegt wurde. Das Finanzamt setzte die Körperschaftsteuer nunmehr auf 140.570 € fest und wies den Einspruch als unbegründet zurück.
| |
Mit der gegen den geänderten Körperschaftsteuerbescheid und die Einspruchsentscheidung erhobenen Klage macht die Klägerin im Ausgangsverfahren geltend, § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG wirke in Verbindung mit der Anwendungsvorschrift des § 43 Abs. 18 | |
III.
| |
Das Finanzgericht hat das Ausgangsverfahren ausgesetzt, um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen (veröffentlicht in EFG 2008, S. 983).
| |
Das vorlegende Gericht hält § 43 Abs. 18 KAGG wegen Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 GG für verfassungswidrig, weil die neue Fassung des § 40a Abs. 1 KAGG nicht lediglich klarstellend sei, sondern eine unzulässige echte Rückwirkung entfalte. § 8b Abs. 3 KStG sei weder unmittelbar auf Anteilscheine anwendbar gewesen, noch habe § 40a Abs. 1 KAGG a.F. die sinngemäße Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG angeordnet, noch folge der Ausschluss der Teilwertabschreibungen vom steuerrechtlichen Abzug bei der Gewinnermittlung aus § 8 Abs. 1 KStG in Verbindung mit § 3c Abs. 1 EStG. Insbesondere der Wortlaut des § 40a Abs. 1 KAGG a.F. mit der dort fehlenden Verweisung auf § 8b Abs. 3 KStG a.F. und eine systematische Auslegung der Vorschrift, wonach die steuerliche Berücksichtigung von Teilwertabschreibungen auf Anteilscheine nicht zu sinnwidrigen Ergebnissen führe, sprächen dafür, dass bis zur Neuregelung des § 40a Abs. 1 KAGG Teilwertabschreibungen bei Anteilscheinen gewinnmindernd berücksichtigungsfähig gewesen seien. Diese Möglichkeit werde rückwirkend versagt. Keine der Ausnahmefallgruppen, in denen eine echte Rückwirkung zulässig sein könne, sei einschlägig.
| |
IV.
| |
Zu dem Vorlagebeschluss haben Stellung genommen das Bundesministerium der Finanzen namens der Bundesregierung, die Bundessteuerberaterkammer, ein Zusammenschluss der Bundesverbände aus dem Bereich des Bankwesens, das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., der Gesamtverband der Deut | |
Das Bundesministerium der Finanzen hält die Vorlage für unzulässig und überdies für unbegründet. Das vorlegende Gericht setze sich nicht näher mit der Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung auseinander. § 43 Abs. 18 KAGG erfülle nicht den Tatbestand einer echten Rückwirkung. Der Verweis in § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG auf § 8b Abs. 3 KStG sei nur deklaratorisch. Bereits § 40a Abs. 1 KAGG a.F. habe die Anwendung des Abzugsverbots nach § 8b Abs. 3 KStG mit eingeschlossen. Das Bundesministerium der Finanzen verweist ferner auf die Urteile des Finanzgerichts München vom 28. Februar 2008 (EFG 2008, S. 991) und vom 17. März 2009 (EFG 2009, S. 1053).
| |
In den übrigen Stellungnahmen wird, soweit sie sich inhaltlich zu den aufgeworfenen Rechtsfragen äußern, die Auffassung des vorlegenden Finanzgerichts Münster geteilt, dass § 43 Abs. 18 KAGG die rückwirkende Anwendung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG in verfassungsrechtlich unzulässiger Weise anordne.
| |
Der Bundesfinanzhof hat inhaltlich nicht Stellung bezogen. Das Offenlassen der verfassungsrechtlichen Frage in seinem Urteil vom 28. Oktober 2009 – I R 27/08 – (BFHE 227, 73) hat er mit der in diesem Fall gemeinschaftsrechtlich bedingten Unanwendbarkeit der Vorschrift begründet.
| |
Die Vorlage ist zulässig.
| |
1. Gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht darlegen, inwiefern seine Entscheidung von der Gültigkeit der zur Prüfung gestellten Norm abhängt (vgl. BVerfGE 105, 48 [56]; 105, 61 [67]; 133, 1 [10 f.]). Dazu muss der Vorlagebeschluss mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, dass das vorlegende Gericht im Falle der Gültigkeit der in Frage gestellten Vorschrift zu einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer Ungültigkeit und wie das Gericht dieses Ergebnis begründen würde (vgl. BVerfGE 105, 61 | |
2. Die Auslegung des § 40a Abs. 1 KAGG a.F. durch das vorlegende Gericht ist vertretbar. Sie lässt sich insbesondere auf den Wortlaut der Vorschrift stützen. Dass die gegenteilige Auslegung der Vorschrift ebenfalls vertretbar erscheint (vgl. die unter A I 2 zitierten Urteile des Finanzgerichts München aus den Jahren 2008 und 2009) und die maßgebliche Rechtsfrage höchstrichterlich noch nicht entschieden ist, steht der Zulässigkeit der Vorlage nicht entgegen. Hierfür genügt es, dass die Auffassung des vorlegenden Gerichts nicht offensichtlich unhaltbar ist. Es gehört nicht zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Antrags auf konkrete Normenkontrolle, die vorherige höchstrichterliche Klärung einer für die verfassungsrechtliche Beurteilung erheblichen Vorfrage des einfachen Rechts abzuwarten. Dagegen spricht schon die Befugnis von erst- oder zweitinstanzlichen Gerichten zum Antrag auf konkrete Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG.
| |
3. Das Finanzgericht hat sich im Vorlagebeschluss hinreichend mit der Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung der einschlägigen einfachrechtlichen Vorschriften befasst und diese verneint. Der Gesetzgeber habe mit der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 18 KAGG in der Fassung des Korb II-Gesetzes bewusst und eindeutig die rückwirkende Anwendung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG auf alle noch nicht bestandskräftigen Veranlagungen festgelegt. Das vorlegende Gericht sieht insofern zu Recht keinen Spielraum bei der Auslegung des § 43 Abs. 18 KAGG.
| |
4. Das vorlegende Gericht war nicht verpflichtet, den Vorlagebeschluss vom 22. Februar 2008 im Hinblick auf mehrere zwischenzeitlich ergangene Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 126, 369; 127, 1; 131, 20; 132, 302) zu ergänzen, die auch für die Vorlage relevante Aussagen zu Fragen der Verfassungsmäßigkeit rückwirkender Gesetze enthalten.
| |
Es besteht keine generelle verfassungsprozessuale Verpflich | |
5. Die auf Anteile an Aktienfonds zielende Vorlagefrage ist dem Wortlaut des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG entsprechend auf Anteile an Wertpapier-Sondervermögen und diesbezügliche Gewinnminderungen zu erstrecken. Die Befriedungsfunktion des Normenkontrollverfahrens (vgl. dazu BVerfGE 132, 302 [316] m.w.N.) spricht für diese Erweiterung der Vorlagefrage. Weitergehende verfassungsrechtliche Fragen werden dadurch nicht aufgeworfen.
| |
Entsprechendes gilt für den Veranlagungszeitraum 2001, auf den die Vorlagefrage zu erstrecken ist. Die nach der Vorlage für den im Ausgangsverfahren entscheidungserheblichen Veranlagungszeitraum 2002 erheblichen Verfassungsrechtsfragen stellen sich in gleicher Weise für das Jahr 2001. Eine Erstreckung der Vorlage auf den Veranlagungszeitraum 2003 kommt hingegen nicht in Betracht, weil die verfassungsrechtliche Beurteilung bezüglich dieses Veranlagungszeitraums (vgl. Finanzgericht Nürnberg, Urteil vom 21. Juli 2009 – 1 K 733/2007 –, EFG 2010, S. 163) schon im Hinblick auf die Einordnung der gesetzlichen Rückwirkung eigene Probleme und teilweise andere Fragen aufwirft.
| |
§ 43 Abs. 18 KAGG ist verfassungswidrig, soweit er für Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit Anteilscheinen an einem Wertpapier-Sondervermögen stehen, die rückwirkende | |
1. § 43 Abs. 18 KAGG hat § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG für die Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 jedenfalls formal mit echter Rückwirkung in Kraft gesetzt.
| |
a) Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet bei rückwirkenden Gesetzen in ständiger Rechtsprechung zwischen Gesetzen mit echter Rückwirkung, die grundsätzlich nicht mit der Verfassung vereinbar sind (vgl. BVerfGE 45, 142 [167 f.]; 101, 239 [262]; 132, 302 [318]; jeweils m.w.N.), und solchen mit unechter Rückwirkung, die grundsätzlich zulässig sind (vgl. BVerfGE 132, 302 [318] m.w.N.).
| |
Eine Rechtsnorm entfaltet echte Rückwirkung, wenn sie nachträglich in einen abgeschlossenen Sachverhalt ändernd eingreift (vgl. BVerfGE 11, 139 [145 f.]; 30, 367 [386]; 101, 239 [263]; 123, 186 [257]; 132, 302 [318]). Dies ist insbesondere der Fall, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon vor dem Zeitpunkt ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll ("Rückbewirkung von Rechtsfolgen"; vgl. BVerfGE 127, 1 [16 f.]).
| |
Im Steuerrecht liegt eine echte Rückwirkung nur vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits entstandene Steuerschuld nachträglich abändert (vgl. BVerfGE 127, 1 [18 f.]; 127, 31 [48 f.]; 127, 61 [77 f.]; 132, 302 [319]). Für den Bereich des Einkommensteuerrechts bedeutet dies, dass die Änderung von Normen mit Wirkung für den laufenden Veranlagungszeitraum jedenfalls in formaler Hinsicht der Kategorie der unechten Rückwirkung zuzuordnen ist; denn nach § 38 Abgabenordnung in Verbindung mit § 36 Abs. 1 EStG entsteht die Einkommensteuer erst mit dem Ablauf des Veranla | |
b) § 43 Abs. 18 KAGG, der durch das am 27. Dezember 2003 verkündete Korb II-Gesetz eingeführt wurde, entfaltet für die beiden Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 in formaler Hinsicht echte Rückwirkung (vgl. BVerfGE 126, 369 [391 f.]), soweit er noch nicht bestandskräftige Festsetzungen für diese Veranlagungszeiträume erfasst. Diese waren am 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres und damit vor Verkündung des Korb II-Gesetzes abgelaufen, so dass die Neuregelung insoweit nachträglich einen abgeschlossenen Sachverhalt betrifft.
| |
2. Die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Verbots echt rückwirkender Gesetze beanspruchen hier auch in materiellrechtlicher Hinsicht Geltung, weil § 40 Abs. 1 Satz 2 KAGG, anders als in der Begründung des Regierungsentwurfs angenommen (vgl. BTDrucks 15/1518, S. 17), aus verfassungsrechtlicher Sicht gegenüber der alten Rechtslage als konstitutive Änderung zu behandeln ist.
| |
a) Würde § 40 Abs. 1 Satz 2 KAGG rückwirkend lediglich das klarstellen, was ohnehin bereits Gesetz war, stellte sich die Frage nicht, ob die Vorschrift trotz formal echter Rückwirkung ausnahmsweise mit dem grundsätzlichen Verbot echt rückwirkender Gesetze vereinbar ist. Das Vertrauen in das geltende Recht könnte dann von vornherein nicht berührt sein, weil das geltende Recht nachträglich keine materielle Änderung erfahren hätte.
| |
Ob eine rückwirkende Gesetzesänderung gegenüber dem alten Recht deklaratorisch oder konstitutiv wirkt, hängt vom Inhalt des alten und des neuen Rechts ab, der – abgesehen von eindeutigen Gesetzesformulierungen – zumeist erst durch Auslegung ermittelt werden muss.
| |
Die in der Begründung des Gesetzentwurfs zu § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG vertretene Auffassung, die Vorschrift habe lediglich klarstellenden Charakter (vgl. BTDrucks 15/1518, S. 17), ist | |
Zur verbindlichen Auslegung einer Norm ist letztlich in aller Regel die rechtsprechende Gewalt berufen (vgl. BVerfGE 65, 196 [215]; 111, 54 [107]; 126, 369 [392]). Dies gilt auch bei der Frage, ob eine Norm konstitutiven oder deklaratorischen Charakter hat. Allerdings ist der Gesetzgeber ebenfalls befugt, den Inhalt einer von ihm gesetzten Norm zu ändern oder klarstellend zu präzisieren und dabei gegebenenfalls eine Rechtsprechung zu korrigieren, mit der er nicht einverstanden ist. Dabei hat er sich jedoch im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu halten, zu der auch die aus den Grundrechten und dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Grenzen für rückwirkende Rechtsetzung gehören. Der Gesetzgeber kann diese Bindung und die Prüfungskompetenz der Gerichte nicht durch die Behauptung unterlaufen, seine Norm habe klarstellenden Charakter (vgl. BVerfGE 126, 369 [392]). Es besteht keine Befugnis des Gesetzgebers zur authentischen Interpretation gesetzlicher Vorschriften (vgl. BVerfGE 126, 369 [392]; 131, 20 [37]).
| |
b) Die Auslegung des einfachen Rechts ist grundsätzlich Sache der Fachgerichte (aa); die Inhaltsbestimmung einer im Normenkontrollverfahren vorgelegten Norm obliegt allerdings regelmäßig dem Bundesverfassungsgericht (bb). Für die Klärung, ob eine rückwirkende Regelung konstitutiven oder deklaratorischen Charakter hat, gelten jedoch Besonderheiten; eine solche Vorschrift ist aus verfassungsrechtlicher Sicht stets schon dann als konstitutiv anzusehen, wenn sie sich für oder gegen eine vertretbare Auslegung einer Norm entscheidet und damit ernstliche Auslegungszweifel im geltenden Recht beseitigt (cc).
| |
aa) Die Auslegung des einfachen Rechts, die Wahl der hierbei anzuwendenden Methoden sowie die Anwendung des Rechts auf den Einzelfall sind primär Aufgabe der dafür zuständigen Fachgerichte und vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich nicht auf ihre Richtigkeit zu untersuchen (vgl. BVerfGE 128, 193 [209]), | |
bb) Soweit es für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle auf die Auslegung und das Verständnis des einfachen Rechts ankommt, erfolgt eine Vollprüfung des einfachen Rechts durch das Bundesverfassungsgericht selbst (vgl. BVerfGE 2, 181 [193]; 7, 45 [50]; 18, 70 [80]; 31, 113 [117]; 51, 304 [313]; 80, 244 [250]; 98, 145 [154]; 110, 412 [438]; stRspr). In diesem Fall ist es an die Auslegung des einfachen Rechts durch das vorlegende Gericht nicht gebunden. Es kann entscheidungserhebliche Vorfragen des einfachen Rechts selbst in vollem Umfang prüfen und darüber als Ausgangspunkt für die verfassungsrechtliche Prüfung entscheiden. Nur so kann verhindert werden, dass das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit einer Norm auf der Grundlage einer womöglich einseitigen, aber noch vertretbaren Deutung veranlasst ist, die ansonsten nicht, auch in der übrigen Fachgerichtsbarkeit nicht, geteilt wird. Das Bundesverfassungsgericht ist freilich nicht gehindert, die im Vorlagebeschluss vertretene Auslegung des einfachen Rechts durch das Fachgericht zu übernehmen und wird dies regelmäßig tun, wenn keine Zweifel an deren Richtigkeit bestehen.
| |
cc) (1) Unbeschadet der grundsätzlichen Befugnis des Bundesverfassungsgerichts zur Vollprüfung des einfachen Rechts im Normenkontrollverfahren genügt für die Beantwortung der Frage, ob eine rückwirkende Regelung aus verfassungsrechtlicher | |
(a) Der Wunsch des Gesetzgebers, eine Rechtslage rückwirkend klarzustellen, verdient grundsätzlich nur in den durch das Rückwirkungsverbot vorgegebenen Grenzen verfassungsrechtliche Anerkennung. Andernfalls könnte der Gesetzgeber auch jenseits dieser verfassungsrechtlichen Bindung einer Rechtslage unter Berufung auf ihre Klärungsbedürftigkeit ohne Weiteres die von ihm für richtig gehaltene Deutung geben, ohne dass von den dafür letztlich zuständigen Gerichten geklärt wäre, ob dies der tatsächlichen Rechtslage entsprochen hat. Damit würde der rechtsstaatlich gebotene Schutz des Vertrauens in die Stabilität des Rechts empfindlich geschwächt. Angesichts der allgemeinen Auslegungsfähigkeit und -bedürftigkeit des Rechts könnte es dem Gesetzgeber regelmäßig gelingen, einen Klärungsbedarf zu begründen. Eine von Vertrauensschutzerfordernissen weitgehend freigestellte Befugnis zur rückwirkenden Klarstellung des geltenden Rechts eröffnete dem Gesetzgeber den weit reichenden Zugriff auf zeitlich abgeschlossene Rechtslagen, ließe im Nachhinein politischen Opportunitätserwägungen Raum, die das einfache Recht zum Zeitpunkt der später als korrekturbedürftig empfundenen Auslegung nicht prägten, und beeinträchtigte so das Vertrauen in die Stabilität des Rechts erheblich.
| |
Ein legislatives Zugriffsrecht auf die Vergangenheit folgt auch nicht ohne Weiteres aus dem Demokratieprinzip, sondern steht zu diesem in einem Spannungsverhältnis. Zwar begrenzt das Rückwirkungsverbot die legislativen Handlungsspielräume des Parlaments für die Vergangenheit. Die demokratische Verantwortung des Parlaments ist jedoch auf die Gegenwart und auf die Zukunft bezogen. Früher getroffene legislative Entscheidungen verfügen über eine eigenständige demokratische Legitimation. Der historische Legitimationskontext kann – jedenfalls soweit die Gesetzeswirkungen in der Vergangenheit liegen – nicht ohne Weiteres | |
(b) Eine rückwirkende Klärung der Rechtslage durch den Gesetzgeber ist in jedem Fall als konstitutiv rückwirkende Regelung anzusehen, wenn der Gesetzgeber damit nachträglich einer höchstrichterlich geklärten Auslegung des Gesetzes den Boden zu entziehen sucht. Der Gesetzgeber hat es für die Vergangenheit grundsätzlich hinzunehmen, dass die Gerichte das damals geltende Gesetzesrecht in den verfassungsrechtlichen Grenzen richterlicher Gesetzesauslegung und Rechtsfortbildung verbindlich auslegen. Entspricht diese Auslegung nicht oder nicht mehr dem politischen Willen des Gesetzgebers, kann er das Gesetz für die Zukunft ändern.
| |
Eine nachträgliche Klärung der Rechtslage durch den Gesetzgeber ist aber grundsätzlich auch dann als konstitutiv rückwirkende Regelung anzusehen, wenn die rückwirkende Regelung eine in der Fachgerichtsbarkeit kontroverse Auslegungsfrage entscheidet, die noch nicht höchstrichterlich geklärt ist. Die klärende Regelung ist bereits dann konstitutiv, wenn sie eine – sei es auch unterinstanzliche – fachgerichtliche Auslegung durch nachträglichen Zugriff auf einen abgeschlossenen Sachverhalt ausschließen soll. Indem der Gesetzgeber mit einem in der maßgeblichen Aussage nunmehr regelmäßig eindeutigen Gesetz rückwirkend die insofern offenbar nicht eindeutige, in ihrer Anwendung jedenfalls uneinheitliche Rechtslage klären will, verleiht er dem rückwirkenden Gesetz konstitutive Wirkung.
| |
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet in diesen Fällen al | |
Ob Bürger oder Behörde im Ausgangsrechtsstreit ihren Rechtsstandpunkt zur alten Rechtslage zu Recht eingenommen haben, ist in einem solchen Fall durch die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass eine konstitutiv rückwirkende Neuregelung vorliegt, nicht entschieden. Hält das Bundesverfassungsgericht – wie hier – die Rückwirkung für verfassungswidrig, ist es weiterhin der Fachgerichtsbarkeit aufgegeben, den Inhalt der alten Rechtslage durch Auslegung zu klären. Dies entspricht der Funktionsteilung zwischen Bundesverfassungsgericht und Fachgerichten. Die weitere, insbesondere höchstrichterliche Auslegung durch die Fachgerichte kann dabei ergeben, dass die Norm gerade so zu verstehen ist, wie es der Gesetzgeber nachträglich festgestellt wissen wollte. Dies bleibt jedoch eine Frage der Auslegung geltenden Rechts, die nicht dem Gesetzgeber, sondern der Gerichtsbarkeit und dabei in erster Linie der Fachgerichtsbarkeit obliegt.
| |
(2) Ausgehend von diesen Grundsätzen erweist sich die rückwirkende "Klarstellung" der Anwendbarkeit des § 8b Abs. 3 KStG a.F. in § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG als konstitutiv. Der Gesetzgeber hat bei der Anfügung des Satzes 2 an § 40a Abs. 1 Satz 1 KAGG seine Absicht der Klarstellung zur Beseitigung des entstandenen Auslegungsproblems zum Ausdruck gebracht (vgl. BTDrucks 15/1518, S. 17). § 40a Abs. 1 KAGG konnte vor der Klärung durch den Gesetzgeber in jeweils vertretbarer Weise im Sinne der An | |
Auch in diesen Konstellationen, in denen es auf die Frage ankommt, ob eine Neuregelung aus verfassungsrechtlicher Sicht deklaratorisch oder konstitutiv wirkt, bleibt es dem Bundesverfassungsgericht allerdings unbenommen, in eigener Zuständigkeit das einfache Recht als Grundlage seiner Entscheidung auszulegen, etwa weil der vom vorlegenden Gericht zum einfachen Recht vertretene Rechtsstandpunkt verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt ist. Verpflichtet dazu ist es in diesen Fällen freilich nicht. Die Vorlage gibt dem Bundesverfassungsgericht hier keine Veranlassung, eine eigenständige Auslegung des einfachen Rechts vorzunehmen, da keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die im Vorlagebeschluss zur Nichtanwendbarkeit des § 8b Abs. 3 KStG a.F. vertretene Rechtsauffassung verfassungswidrig sein könnte.
| |
3. Die mit der konstitutiven Wirkung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG verbundene Belastung ist verfassungswidrig, soweit sie nach § 43 Abs. 18 KAGG hinsichtlich der Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 mit echter Rückwirkung versehen ist.
| |
Die im Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes stehen Gesetzen mit echter Rückwirkung grundsätzlich entgegen (a). Keine der in der Rechtsprechung anerkannten Ausnahmen von diesem Verbot liegt hier vor (b). Auch ansonsten ist hier kein Grund für die Rechtfertigung der echten Rückwirkung erkennbar (c).
| |
a) Die Verfassungsmäßigkeit eines rückwirkenden Gesetzes ist | |
b) aa) Von diesem grundsätzlichen Verbot echt rückwirkender Gesetze bestehen jedoch Ausnahmen (vgl. BVerfGE 13, 261 [272 f.]; 18, 429 [439]; 30, 367 [387 f.]; 50, 177 [193 f.]; 88, 384 [404]; 95, 64 [86 f.]; 101, 239 [263 f.]; 122, 374 [394 f.]; 126, 369 [393 f.]; 131, 20 [39]; stRspr). Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht nur seinen Grund, sondern auch seine Grenze (vgl. BVerfGE 88, 384 [404]; 122, 374 [394]; 126, 369 [393]). Es gilt nicht, soweit sich kein Vertrauen auf | |
Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unzulässigkeit echter Rückwirkungen ist gegeben, wenn die Betroffenen schon im Zeitpunkt, auf den die Rückwirkung bezogen wird, nicht auf den Fortbestand einer gesetzlichen Regelung vertrauen durften, sondern mit deren Änderung rechnen mussten (vgl. BVerfGE 13, 261 [272]; 30, 367 [387]; 95, 64 [86 f.]; 122, 374 [394]). Vertrauensschutz kommt insbesondere dann nicht in Betracht, wenn die Rechtslage so unklar und verworren war, dass eine Klärung erwartet werden musste (vgl. BVerfGE 13, 261 [272]; 18, 429 [439]; 30, 367 [388]; 50, 177 [193 f.]; 88, 384 [404]; 122, 374 [394]; 126, 369 [393 f.]), oder wenn das bisherige Recht in einem Maße systemwidrig und unbillig war, dass ernsthafte Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit bestanden (vgl. BVerfGE 13, 215 [224]; 30, 367 [388]). Der Vertrauensschutz muss ferner zurücktreten, wenn überragende Belange des Gemeinwohls, die dem Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen, eine rückwirkende Beseitigung erfordern (vgl. BVerfGE 13, 261 [272]; 18, 429 [439]; 88, 384 [404]; 95, 64 [87]; 101, 239 [263 f.]; 122, 374 [394 f.]), wenn der Bürger sich nicht auf den durch eine ungültige Norm erzeugten Rechtsschein verlassen durfte (vgl. BVerfGE 13, 261 [272]; 18, 429 [439]; 50, 177 [193 f.]; 101, 239 [263 f.]; 122, 374 [394 f.]) oder wenn durch die sachlich begründete rückwirkende Gesetzesänderung kein | |
bb) Von den in der Rechtsprechung anerkannten Fallgruppen zulässigerweise echt rückwirkender Gesetze kommen hier nur diejenigen der Unklarheit und Verworrenheit der ursprünglichen Gesetzeslage oder ihrer Systemwidrigkeit und Unbilligkeit in Betracht. Keine von beiden vermag die Rückwirkung des § 43 Abs. 18 KAGG auf die Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 zu rechtfertigen.
| |
(1) (a) Allein die Auslegungsbedürftigkeit einer Norm rechtfertigt nicht deren rückwirkende Änderung; erst wenn die Auslegungsoffenheit ein Maß erreicht, das zur Verworrenheit der Rechtslage führt, darf der Gesetzgeber eine klärende Neuregelung auf die Vergangenheit erstrecken.
| |
Den in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannten Fallgruppen zu den Ausnahmen vom Verbot echt rückwirkender Gesetze ist sämtlich gemeinsam, dass besondere Umstände ein grundsätzlich berechtigtes Vertrauen in die bestehende Rechtslage erst gar nicht entstehen lassen oder entstandenes Vertrauen wieder zerstören. Die schlichte Auslegungsoffenheit und Auslegungsbedürftigkeit einer Norm und die damit bestehende Unsicherheit über deren Inhalt ist keine solche Besonderheit, die dieses grundsätzlich berechtigte Vertrauen zerstören könnte. Andernfalls könnte sich insbesondere in den Anfangsjahren einer gesetzlichen Regelung grundsätzlich nie ein schutzwürdiges Vertrauen gegen rückwirkende Änderungen entwickeln, solange sich keine gefestigte Rechtsprechung hierzu herausgebildet hat.
| |
Sähe man jede erkennbare Auslegungsproblematik als Entstehungshindernis für verfassungsrechtlich schutzwürdiges Vertrauen an, stünde es dem Gesetzgeber weitgehend frei, das geltende Recht immer schon dann rückwirkend zu ändern, wenn es ihm opportun erscheint, etwa weil die Rechtsprechung das geltende Recht in einer Weise auslegt, die nicht seinen Vorstellungen und Erwartungen entspricht. In diesem Fall kann der Gesetzgeber zwar stets die Initiative ergreifen und das geltende Recht für die Zukunft in seinem Sinne ändern, sofern er sich dabei an die Vor | |
Außerdem würde eine über besondere Ausnahmefälle hinausgreifende Befugnis des Gesetzgebers zur rückwirkenden Präzisierung von Normen, die sich als auslegungsbedürftig erweisen, die vom Grundgesetz der rechtsprechenden Gewalt vorbehaltene Befugnis zur verbindlichen Auslegung von Gesetzen unterlaufen (vgl. BVerfGE 126, 369 [392]).
| |
Da sich Auslegungsfragen gerade bei neuen Normen häufig stellen, bestünde die Gefahr, dass auf diese Weise schließlich das Regel-Ausnahme-Verhältnis bei der echten Rückwirkung in dem Sinne in sein Gegenteil verkehrt würde, dass auch sie nicht mehr grundsätzlich unzulässig bliebe, sondern – ebenso wie die unechte Rückwirkung – grundsätzlich zulässig wäre. Ein solches Ergebnis wäre mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit nicht vereinbar.
| |
(b) Die eine echt rückwirkende gesetzliche Klärung rechtfertigende Unklarheit einer Rechtslage erfordert vielmehr zusätzliche qualifizierende Umstände, die das geltende Recht so verworren erscheinen lassen, dass es keine Grundlage für einen verfassungsrechtlich gesicherten Vertrauensschutz mehr bilden kann. Eine solche Verworrenheit liegt insbesondere dann vor, wenn auch unter Berücksichtigung von Wortlaut, Systematik und Normzweck völlig unverständlich ist, welche Bedeutung die fragliche Norm haben soll.
| |
(c) § 40a Abs. 1 KAGG ließ vor der hier zu prüfenden Einfügung des Satzes 2 verschiedene Auslegungen zu. Das belegen die divergierenden finanzgerichtlichen Entscheidungen zur Auslegung dieser Vorschrift. Die höchstrichterlich nicht geklärte Auslegung im Hinblick auf die Anwendung des im ursprünglichen Wortlaut nicht erwähnten § 8b Abs. 3 KStG a.F. und die insoweit uneinheitliche Rechtsprechung auf der Ebene der Finanzgerichte | |
(2) Das ursprüngliche einfache Recht war auch nicht in einer Weise systemwidrig und unbillig, dass dies die durch § 43 Abs. 18 KAGG angeordnete echte Rückwirkung rechtfertigen könnte.
| |
Weder die Auslegung des vorlegenden Finanzgerichts (keine Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG) noch die gegenteilige Auslegung des ursprünglichen § 40a Abs. 1 KAGG (Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG) sind von Verfassungs wegen zwingend geboten. Zwar mögen im vorliegenden Zusammenhang systematische und teleologische Aspekte bei der Interpretation des ursprünglichen § 40a Abs. 1 KAGG gute Gründe für ein von der reinen Wortlautauslegung abweichendes Auslegungsergebnis im Sinne der Anwendbarkeit des § 8b Abs. 3 KStG a.F. liefern (vgl. Gosch, in: Gosch, KStG, 1. Aufl. 2005, § 8b Rn. 52 und 2. Aufl. 2009, § 8b Rn. 49). Ungeachtet dessen führt auch die Sichtweise des vorlegenden Finanzgerichts nicht zu einem Ergebnis, das in einem Maße systemwidrig und unbillig ist, dass ernsthafte Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit bestehen (vgl. BVerfGE 13, 215 [224]; 30, 367 [388]).
| |
Den Gesetzesmaterialien zum Korb II-Gesetz lassen sich allerdings keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Gesetzgeber Kapitalanlagegesellschaften gegenüber Körperschaften, für die das Körperschaftsteuergesetz unmittelbar gilt, im Hinblick auf die Anwendung des § 8b Abs. 3 KStG privilegieren wollte. Andererseits war das Transparenzprinzip im Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften nicht uneingeschränkt verwirklicht; es galt vielmehr nur gemäß der jeweiligen Anordnung des Gesetzgebers (sogenanntes eingeschränktes Transparenzprinzip, vgl. BFHE 130, 287 [289]; 168, 111 [113]; 193, 330 [333 f.]; 229, 351 | |
Vor dem Hintergrund der Besonderheiten des Investmentsteuerrechts und des dieses prägenden eingeschränkten Transparenzprinzips führt die Auslegung durch das vorlegende Finanzgericht nicht zu einer so systemwidrigen und unbilligen Begünstigung der Kapitalanlagegesellschaften, dass bereits ernsthafte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Auslegung bestünden. Zwar erscheint systematisch fragwürdig, weshalb – abweichend vom "normalen" neuen Körperschaftsteuersystem – positive Wertentwicklungen nicht der Besteuerung unterliegen, negative Wertentwicklungen hingegen steuerliche Berücksichtigung finden sollten. Immerhin aber wurde durch § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG a.F. (inzwischen Satz 4) eine systemwidrige Begünstigung durch eine Steuerwirksamkeit von Gewinnminderungen und eine Steuerfreistellung der auf die nämlichen Beträge entfallenden Gewinne vermieden. Nach dieser Vorschrift gilt die Veräußerungsgewinnbefreiung nicht, "soweit der Anteil in früheren Jahren steuerwirksam auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben und die Gewinnminderung nicht durch den Ansatz eines höheren Werts ausgeglichen worden ist". § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG a.F. war unzweifelhaft schon nach dem Wortlaut von der auf § 8b Abs. 2 KStG zielenden Verweisung in § 40a Abs. 1 KAGG a.F. erfasst. Die Auslegung durch das vorlegende Finanzgericht führt daher nicht dazu, dass Kapitalanlagegesellschaften Gewinnminderungen von Anteilen an Wertpapier-Sondervermögen steuerwirksam berücksichtigen durften, auf die jeweiligen Anteile entfallende Gewinne aber nicht zu versteuern brauchten.
| |
Daher kann von einer systemwidrigen Abwälzung der Verluste der Kapitalanlagegesellschaften auf die Allgemeinheit nicht die Rede sein. Eine Ausgestaltung der Besteuerung von Kapitalanlagegesellschaften im Sinne der Auffassung des vorlegenden Ge | |
c) Sonstige Gründe, die jenseits der in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannten Fallgruppen hier ausnahmsweise eine gesetzliche Regelung mit echter Rückwirkung rechtfertigen könnten, liegen nicht vor. Anderes ergibt sich auch nicht aus den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli 2010 zum Fremdrentenrecht (BVerfGE 126, 369) und vom 2. Mai 2012 zum Dienstrechtsneuordnungsgesetz (BVerfGE 131, 20), in denen das Gericht jeweils rückwirkende Gesetzesänderungen als verfassungsgemäß beurteilt hat.
| |
In dem Beschluss zum Fremdrentenrecht sah das Gericht, unabhängig von der Frage, ob die in Streit stehende rückwirkende Gesetzesänderung konstitutiv wirkte, das Vertrauen in ein geändertes Verständnis der alten Rechtslage, das durch eine Rechtsprechungsänderung des Bundessozialgerichts in Abweichung von der bis dahin in Rechtspraxis und Rechtsprechung gefestigten Rechtsauffassung herbeigeführt worden war, als von vornherein nicht gerechtfertigt an (vgl. BVerfGE 126, 369 [393 ff.]). Mit dieser Sondersituation ist der vorliegende Fall nicht vergleichbar.
| |
Entsprechendes gilt für die Entscheidung zum Dienstrechtsneuordnungsgesetz. Ihr lag ein Fall zugrunde, in dem das Bundesverwaltungsgericht eine gefestigte Rechtspraxis zur Berechnung des Mindestruhegehalts bei Zusammentreffen von beamtenrechtlicher Versorgung und gesetzlicher Rente änderte. Die Korrektur dieser Rechtsprechung durch den Gesetzgeber bewertete das Bundesverfassungsgericht zwar als konstitutive Gesetzesänderung mit zum Teil echter und zum Teil unechter Rückwirkung (vgl. BVerfGE 131, 20 [36 ff.]), stellte aber zugleich fest, dass sich ein hinreichend gefestigtes und damit schutzwürdiges Vertrauen in ein Verständnis der Rechtslage im Sinne des Bundesverwaltungsgerichts unter den gegebenen Umständen nicht habe entwickeln können (vgl. BVerfGE 131, 20 [41 ff.]). Auch hier bezieht sich die Entscheidung mithin auf eine besondere Situation, der sich der Gesetzgeber angesichts einer kurzfristigen Änderung der | |
d) Es besteht kein Anlass, für die Fälle, in denen der Gesetzgeber die geltende Rechtslage für die Vergangenheit klarstellen will, von dem im Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten verankerten Vertrauensschutz und dem darin wurzelnden Ausnahmecharakter zulässiger echter Rückwirkung abzuweichen. Eine solche Abweichung wäre es jedoch, wenn dem Wunsch des Gesetzgebers, den "wahren" Inhalt früher gesetzten Rechts nachträglich festzulegen und eine seinen Vorstellungen widersprechende Auslegung auch für die Vergangenheit zu korrigieren, Grenzen nur im Hinblick auf bestands- oder rechtskräftig abgeschlossene Einzelverfahren oder bei Rechtslagen gesetzt wären, die keinen ernsthaften Auslegungsspielraum lassen. Damit würde der in der ständigen Rechtsprechung entwickelte besondere Schutz gegen Gesetze mit echter Rückwirkung ebenso preisgegeben wie die Differenzierung zwischen grundsätzlich unzulässiger echter und grundsätzlich zulässiger unechter Rückwirkung.
| |
III.
| |
Soweit § 43 Abs. 18 KAGG zur Anwendung des § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG in den körperschaftsteuerlichen Veranlagungszeiträumen 2001 und 2002 führt, verstößt diese Anwendungsvorschrift gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes und ist nichtig (§ 78 Satz 1 i.V.m. § 82 Abs. 1 BVerfGG).
| |
IV.
| |
Die Entscheidung ist im Ergebnis mit 5 : 3 Stimmen, hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Grundsätze mit 6 : 2 Stimmen ergangen.
| |
(gez.) Kirchhof Gaier Eichberger Schluckebier Masing Paulus Baer Britz | |
Ich kann der Entscheidung nicht zustimmen. Entgegen ihrem ersten Anschein betrifft die Entscheidung nicht fachrechtliche Spezialprobleme, sondern grundsätzliche Fragen zur Reichweite der Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers für unklare, offengebliebene Rechtsfragen der Vergangenheit – hier für steuerrechtliche Abschreibungsmöglichkeiten von Verlusten, die Finanzinstitute insbesondere in Folge der Anschläge des 11. September 2001 erlitten haben. Unter Berufung auf das Rückwirkungsverbot untersagt der Senat dem Gesetzgeber eine Klarstellung, dass diese Verluste nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden dürfen.
| |
Damit verändert er der Sache nach das Fundament der Rückwirkungsrechtsprechung. Der Senat entzieht ihr – nicht dem Selbstverständnis nach, doch in Ergebnis und Begründung – die im Vertrauensschutz liegenden Wurzeln und ersetzt sie durch abstrakte, in der Sache fehlgeleitete Vorstellungen der Gewaltenteilung. An die Stelle des Schutzes subjektiver Freiheit tritt die Absicherung eines objektiv-rechtlichen Reservats der Fachgerichtsbarkeit. Der Verlierer ist das Parlament: In Umwertung der bisherigen Rechtsprechung wird ihm die rückwirkende Klarstellung ungeklärter Rechtsfragen nun nicht erst bei einem entgegenstehenden Vertrauen der Bürger, sondern grundsätzlich abgeschnitten. Die Übernahme von politischer Verantwortung wird ihm so für Altfälle schon prinzipiell aus der Hand geschlagen. Hierin liegt eine gravierende Störung der Balance zwischen Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip.
| |
I.
| |
Der Senat hebt die angegriffene Vorschrift wegen eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot auf, obwohl er selbst der Auffassung ist, dass die ursprüngliche Rechtslage dem Beschwerdeführer keinerlei Vertrauen vermittelt hat, das durch die Gesetzesänderung enttäuscht würde. Damit entzieht er dem | |
1. Gegenstand der in Frage stehenden Normen ist die Frage, ob Kapitalgesellschaften – in der Praxis insbesondere Banken – berechtigt sind, Wertverluste ihrer Anteile an Investmentfonds für die Jahre 2001 und 2002 steuerlich gewinnmindernd geltend zu machen, während das Gesetz Gewinne grundsätzlich steuerfrei stellt. Der Senat selbst ist der Auffassung, dass die Klägerin des Ausgangsverfahrens zu keiner Zeit ein berechtigtes Vertrauen dahin hatte, Teilwertabschreibungen für diese Zeit gewinnmindernd geltend machen zu können. Er hält die ursprüngliche Rechtslage diesbezüglich zu Recht für ungeklärt und erkennt an, dass sie sich sowohl subjektiv als auch bei verobjektivierter Betrachtung für die betroffenen Banken als offen darstellte. Dennoch ist er der Ansicht, dass der Gesetzgeber dies für die noch offenen Altfälle nicht rückwirkend klären durfte. Es sei Aufgabe der Fachgerichte, über diese Fälle zu entscheiden.
| |
Mit dieser Argumentation wird die Fundierung des Rückwirkungsverbots im Vertrauensschutz der Sache nach aufgegeben: Der Senat geht ausdrücklich davon aus, dass die Fachgerichte für die hier in Rede stehenden Fälle in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis kommen können, dass der alte § 40a Abs. 1 Satz 2 KAGG auch unabhängig von der gesetzlichen Klarstellung in § 43 Abs. 18 KAGG sachgerecht so auszulegen ist, dass die von der Klägerin geltend gemachten Teilwertabschreibungen nicht gewinnmindernd berücksichtigt werden können. Diese Frage dürfe rückwirkend aber nicht der Gesetzgeber klären; die Klärung sei allein den Fachgerichten vorbehalten. Dem Gesetzgeber wird so eine Regelung verboten, die die Gerichte durch Auslegung ohne weiteres herbeiführen dürfen. Obwohl die alte Rechtslage kein Vertrauen der Bürger begründete, im Blick auf insoweit vorhersehbare Rechtsfolgen Dispositionen zu treffen, soll der Gesetzgeber an einer Klärung dennoch durch das – aus dem Vertrauensschutz hergeleitete – Rückwirkungsverbot gehindert sein. Die Instrumente des Vertrauensschutzes werden ihm so für die Anordnung von Rechtsfolgen ent | |
2. Wenn hier überhaupt noch eine Brücke zu irgendeiner Form von Vertrauen auszumachen ist, so kann diese allenfalls in dem abstrakten Vertrauen auf die Gültigkeit einer inhaltsoffenen Norm gesucht werden – und damit auf eine Streitentscheidung der politisch offen gebliebenen Frage durch die Fachgerichte. Geschützt wird durch die Entscheidung des Senats das Vertrauen in die Chance einer für die Betreffenden günstigen Rechtsprechung. Gerade dies aber zeigt, wie weit sich der Senat von dem ursprünglichen Anliegen der Rückwirkungsrechtsprechung entfernt. Das Rückwirkungsverbot sichert nicht mehr das Vertrauen in eine berechenbare Rechtsordnung, damit der Einzelne sein Verhalten im Blick auf vorhersehbare Rechtsfolgen selbstbestimmt ausrichten kann, sondern lediglich die Chance, dass die Rechtsprechung möglicherweise zu einer vorteilhafteren Klarstellung der ungeklärten Position führt als eine demokratisch-politische Entscheidung des Parlaments. Galt die Rückwirkungsrechtsprechung zunächst dem Schutz des Vertrauens zur Sicherung individueller Freiheitswahrnehmung, so gilt sie nun der Absicherung eines kompetentiellen Vorbehaltsbereichs der Rechtsprechung gegenüber dem Gesetzgeber. Aus dem Schutz subjektiver Freiheit wird die Durchsetzung objektiver Gewaltenteilungsvorstellungen und hierbei eines Reservats der Rechtsprechung.
| |
II.
| |
Das damit vom Senat zur Geltung gebrachte Verhältnis von Gesetzgebung und Rechtsprechung lässt sich aus der Ordnung des Grundgesetzes nicht herleiten. Es drängt den Gesetzgeber unberechtigt aus seiner Verantwortung.
| |
1. Durch die Ablösung des Rückwirkungsverbots von dem Vertrauen in eine bestimmte Rechtslage wird es für die Fälle der echten Rückwirkung im Ergebnis zu einem apriorischen Prinzip der Gewaltenteilung verselbständigt, das seinen Sinn darin hat, die rückwirkende Einmischung des Gesetzgebers in offene, noch ungeklärte Rechtsfragen schon prinzipiell auszuschalten. Statt einer | |
a) Dies überzeugt schon vom Grundverständnis nicht. Ausgehend von dem aus dem Demokratieprinzip folgenden legislativen Zugriffsrecht des Parlaments kann sich der Gesetzgeber aller drängenden Fragen des Gemeinwesens annehmen. Zu entscheiden, was Recht sein soll, ist im demokratischen Rechtsstaat grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, der hierfür gewählt wird und sich in einem politischen Prozess vor der Öffentlichkeit verantworten muss. Dies betrifft grundsätzlich auch die Entscheidung über Probleme, die in der Vergangenheit wurzeln, oder die Klärung von Streitfragen, die offengeblieben und lösungsbedürftig sind. Dass diese demokratische Verantwortung von vornherein auf die Zukunft beschränkt wäre, ist durch nichts begründet und lässt sich insbesondere auch der bisherigen Rechtsprechung nicht entnehmen. Insbesondere lassen sich hierfür nicht die Vorstellung eines je begrenzten historischen Legitimationskontextes und die eigene Dignität des je auf Zeit gewählten Gesetzgebers anführen. Denn auch mit solchen rückwirkenden Regelungen geht es um die Bewältigung von Problemen, die in der Vergangenheit gerade nicht inhaltlich sachhaltig bewältigt wurden und nun – offen und lösungsbedürftig – in die Gegenwart und Zukunft hineinwirken.
| |
In der Tat freilich ist der Gesetzgeber in seiner Gestaltungsbefugnis rechtsstaatlich begrenzt und diese rechtsstaatlichen Grenzen können bei Gesetzen, die in die Vergangenheit hineinwirken, schneller berührt sein als bei anderen. So kann der Gesetzgeber selbstverständlich nicht ohne weiteres nachträglich in bestands- oder rechtskräftig abgeschlossene Einzelverfahren eingreifen oder für abgeschlossene Zeiträume ein Verhalten neu bewerten und mit Sanktionen belegen, mit denen die Betreffenden nicht rechnen mussten. Insbesondere die Grundrechte und die aus ihnen folgende Freiheitsvermutung setzen hier vielfach Grenzen. Dies ist der zutreffende Kern der Rückwirkungsrechtsprechung. Solche Einschränkungen des Gesetzgebers müssen sich aber jeweils mit einem spezifischen Schutzbedürfnis der Betroffenen be | |
b) Aus Gewaltenteilungsgesichtspunkten spricht vielmehr umgekehrt alles dafür, in ungeklärten Rechtslagen die rückwirkende Klarstellung offener und umstrittener Fragen auch durch den Gesetzgeber grundsätzlich für zulässig zu halten. Wenn sich in der Anwendungspraxis eines Gesetzes herausstellt, dass wichtige Fragen von allgemeiner Bedeutung offengeblieben oder Regelungen unklar oder missverständlich formuliert sind, gehört es zur Aufgabe der Volksvertretung, dass sie in politisch-demokratischer Verantwortung gesetzlich klarstellen kann, wie diese Fragen in den noch offenen Verfahren zu beantworten sind. Die Vorstellung, der Gesetzgeber habe nur einen Versuch frei, dürfe dann aber auf die im Laufe der Zeit aufkommenden Probleme bis zu einer Neuregelung pro futuro keinen klärenden Zugriff mehr nehmen, hat in den Legitimationsgrundlagen unserer Verfassungsordnung kein Fundament. Insbesondere lässt sich dies nicht mit Vorstellungen zeitlich segmentierter Legitimationszusammenhänge begründen. Denn der alte Gesetzgeber hatte hier die entsprechenden Fragen gerade nicht geklärt. Dies wird besonders deutlich, wenn der Gesetzgeber, wie vorliegend, nur das festschreiben will, was seiner Ansicht nach – mehr als nachvollziehbar (siehe unten IV.) – ohnehin auch mit der alten Regelung intendiert war. | |
a) Angesichts der immer komplexer werdenden Anforderungen an die Gesetzgebung in einer hochdifferenzierten und sektoral wie international vielfältig vernetzten Welt kann nicht ernsthaft erwartet werden, dass alle Auswirkungen eines Gesetzgebungsvorhabens stets verlässlich von vornherein überschaut werden können. Normen können im Interessengeflecht der zahlreichen Anwender und Betroffenen Missverständnisse, Zweifelsfragen oder sinnwidrige Praktiken hervorrufen, die nicht vorhersehbar sind. Auch muss damit gerechnet werden, dass dabei dem Gesetzgeber Ungenauigkeiten oder Fehler unterlaufen. Gerade eine Gesetzesreform, wie sie den hier streitigen Normen zugrunde liegt, macht das besonders deutlich. Der Gesetzgeber hatte damals die Herkulesaufgabe auf sich genommen, das gesamte Körperschaftsteuerrecht vom Anrechnungsverfahren auf das Halbeinkünfteverfahren umzustellen und damit die Besteuerung fast aller bedeutsamen Unternehmen – mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Konzernstrukturen ebenso wie auf internationale Zusammenhänge – auf grundlegend neue Füße zu stellen. Die hier in Frage stehenden Normen bildeten dabei nur einen ganz kleinen, untergeordneten Aspekt. Dass im Rahmen eines solchen Vorhabens nicht sofort alle Fragen eine klare, durchdachte und unmissverständliche Lösung erfahren, liegt auf der Hand – und davon mussten alle Betroffenen ausgehen.
| |
b) Nach Ansicht des Senats sind alle insoweit aufkommenden Probleme bis auf Widerruf für die Zukunft grundsätzlich allein durch die Gerichte zu klären. Zwar dürfe der Gesetzgeber aufkommende Unklarheiten pro futuro neu regeln, jedoch seien gesetzliche Unzuträglichkeiten und Streitfragen, die unter einer gegebenen Rechtslage entstehen, – bis auf extreme Ausnahmen (siehe unten IV. 3) – ausschließlich von den Gerichten zu bewältigen.
| |
Dies ist schon im Blick auf die den Gerichten im gewaltenteiligen Verfassungsstaat zugewiesene Aufgabe nicht überzeugend: Während diese angesichts unklarer Rechtslagen nach dem vom | |
Ein solcher Ansatz leuchtet auch hinsichtlich der praktischen Konsequenzen nicht ein. Während eine rückwirkende Klarstellung durch den Gesetzgeber mit einem Schlag unmittelbar alle offenen Streitfälle einheitlich für Zukunft und Vergangenheit lösen und Rechtssicherheit schaffen kann, müssen als Folge der Entscheidung des Senats stattdessen alle vor der Gesetzesänderung angefallenen Fälle vor Gericht durch die Instanzen prozessiert werden. Das kann Jahre dauern, die Gerichte mit vielen Verfahren belasten, für die Betroffenen hohe Kosten mit sich bringen und für lange Zeit Rechtszersplitterung und Verunsicherung zur Folge haben. Die vom Senat aus der Taufe gehobene Chance des Bürgers auf eine für ihn vorteilhafte Entscheidung durch die Rechtsprechung, ist damit nicht nur Chance, sondern auch erhebliche Bürde – nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für die Betroffenen selbst.
| |
III.
| |
In der Entscheidung liegt damit zugleich eine tiefgreifende Wende der Rückwirkungsrechtsprechung und ein Bruch mit den diesbezüglichen bisherigen Wertungen.
| |
Allerdings knüpft der Senat an Obersätze an, die der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entnommen sind: Die grundsätzliche Unzulässigkeit der echten Rückwirkung entspricht ständiger – und in ihrem bisherigen Kontext auch zutreffender – Rechtsprechung. Wie die zahlreichen Zitatketten aus der Rechtsprechung zeigen, ist der Senat dabei von dem Anliegen getragen, diese lediglich stimmig weiterzuentwickeln. Dies gelingt jedoch überzeugend nicht. Denn er löst dabei die Obersätze von ihrer bisherigen Einbindung an die Grundsätze des Vertrauensschutzes ab und verselbständigt sie zu für sich stehenden abstrakten Regeln. Dies gibt ihnen eine neue Bedeutung, die wesentlich | |
1. a) Mit der Nichtigkeitserklärung von Gesetzen wegen Verstoßes gegen das Verbot echter Rückwirkung war das Bundesverfassungsgericht bisher zurückhaltend. In der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts finden sich hierfür nur zwei Fälle und diese liegen lange zurück (vgl. BVerfGE 18, 429; 30, 272). Die Dogmatik hat sich seither naturgemäß weiterentwickelt und die Begründungen würden heute vielleicht differenzierter ausfallen. Im entscheidenden Punkt besteht jedoch Klarheit: In beiden Fällen stellte das Gericht ausdrücklich auf eine konkret vertrauensbegründende Rechtslage ab.
| |
So begründete das Gericht in der ersten Entscheidung vom 31. März 1965 die Verfassungswidrigkeit der dort streitbefangenen Norm maßgeblich damit, dass die vom Gesetzgeber rückwirkend geänderte Rechtslage zwar zunächst von einigen Untergerichten verkannt, dann aber zugunsten der betroffenen Bürger vom Bundesgerichtshof höchstrichterlich geklärt war und diese Klärung sich zutreffend auf Grundsätze stützte, die "allgemeiner, in Rechtsprechung und Literatur einmütig vertretener Auffassung" entsprächen (vgl. BVerfGE 18, 429 [437]). Die Rechtslage sei nicht unklar, sondern "völlig klar" gewesen. Demgegenüber habe der Gesetzgeber versucht, die Rechtsprechung "gleichsam für die Vergangenheit ins Unrecht zu setzen" (a.a.O.S. 439). Auch vom Sachverhalt her ging es um eine Konstellation, die der Frage des Vertrauensschutzes wesentlich näher stand, nämlich um Regressforderungen des Staates für in der Vergangenheit über acht Jahre gezahlte Unterhaltsleistungen an ein Kind, von denen der unerwartet in Anspruch genommene Bürger bis dahin nichts wusste.
| |
In der zweiten Entscheidung vom 10. März 1971 ging es um einen nachträglich für vorangehende steuerliche Veranlagungszeiträume vom Gesetzgeber eingeführten Progressionsvorbehalt, für den bis dahin unstreitig keinerlei Rechtsgrundlage bestand und der dazu führte, dass rückwirkend die Steuern höher ausfielen als nach der ursprünglichen Rechtslage. Das Gericht stellte hier darauf ab, dass das Vertrauen der Betroffenen enttäuscht | |
b) Erst recht stellte das Bundesverfassungsgericht auf die Enttäuschung eines durch die ursprüngliche Rechtslage spezifisch begründeten Vertrauens in den Fällen ab, in denen es Gesetze mit unechter Rückwirkung für verfassungswidrig befand. Da eine unechte Rückwirkung grundsätzlich zulässig ist und nur bei Vorliegen besonderer Vertrauenstatbestände zur Verfassungswidrigkeit führt, bedurfte es hier schon vom Ausgangspunkt her des Nachweises eines spezifischen Vertrauens (so zum Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Ausstellung eines Flüchtlingsausweises BVerfGE 59, 128 [164 ff.]; in die bisher erlaubte Widerrufbarkeit freiwillig gewährter Vorsorgeleistungen BVerfGE 74, 129 [155 ff.]; in die Fortdauer der Besteuerungsregelungen von Abfindungsvereinbarungen BVerfGE 127, 31 [49 ff.]). Nichts anderes gilt dabei für die insoweit besonders gelagerten, der echten Rückwirkung angenäherten Fälle, in denen für einen noch nicht abgelaufenen steuerlichen Veranlagungszeitraum rückwirkende Änderungen in Frage standen und für verfassungswidrig erklärt wurden (vgl. BVerfGE 72, 200; 127, 1; 127, 61; 132, 302). Dort mag man bei formaler Betrachtung zwar eine gewisse Relativierung des Vertrauenskriteriums sehen, da der Einzelne für den Veranlagungszeitraum einfachrechtlich mit einer rückwirkenden Änderung der Vorschriften stets rechnen müssen soll; tatsächlich verbindet die Rechtsprechung, indem sie dies teilweise für nicht hinnehmbar hält, die Rückwirkungslehre für diese Konstellation in spezifischer Weise mit dem eigenständigen Schutzaspekt der Rechtssicherheit. Auch dort aber bestand – ohne dass diese Entscheidungen hier in allen Aspekten zu würdigen wären – zunächst jedenfalls immer eine klare Rechtslage, die als solche geeignet war, Vertrauen für Dispositionen zu begründen und die durch | |
Weitere Fälle, in denen das Bundesverfassungsgericht Gesetze wegen eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot aufgehoben hat, finden sich nicht. Insbesondere gibt es keinen Fall, in dem die Klarstellung einer unsicheren Rechtslage, die kein Vertrauen begründen konnte, für verfassungswidrig erklärt wurde.
| |
2. Der Bruch mit den Wertungen der bisherigen Rechtsprechung wird um so deutlicher, wenn man umgekehrt die Fälle betrachtet, in denen das Bundesverfassungsgericht rückwirkende Gesetze zur Klärung offener Rechtsfragen als verfassungsrechtlich unbedenklich angesehen hat. Es reicht dabei, auf die Fälle einzugehen, in denen der Gesetzgeber in Reaktion auf unvorhergesehene Entwicklungen bei der Anwendung die bisherige Rechtslage lediglich bekräftigen wollte und die Klarstellung deshalb als "authentische Interpretation" verstand. Es zeigt sich dabei, dass der Senat mit der vorliegenden Entscheidung auch in der materiellen Bewertung wesentlich strengere Maßstäbe anlegt als die Rechtsprechung bisher.
| |
a) In der Tat allerdings hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt entschieden, dass eine eigene Befugnis des Gesetzgebers zur "authentischen Interpretation" nicht anzuerkennen ist. Die Auslegung unklarer Rechtsnormen sei grundsätzlich Sache der Gerichte (vgl. BVerfGE 126, 369 [392]; 131, 20 [37 ff.]; ähnlich bereits BVerfGE 111, 54 [107]). Auch diese Aussage blieb aber bisher stets in den Kontext des Vertrauensschutzes eingebunden. Sie wendet sich lediglich dagegen, die Berufung auf eine "authentische Interpretation" als eigenständigen Titel zur Rechtfertigung rückwirkender Gesetze anzuerkennen. Mit ihr sollte auf die allgemeinen – und damit vertrauensschutzbezogenen – Rückwirkungsgrundsätze verwiesen werden. Ausdrücklich hielt der Senat deshalb fest: "Eine durch einen Interpretationskonflikt zwischen Gesetzgeber und Rechtsprechung ausgelöste Normsetzung ist nicht anders zu beurteilen als eine durch sonstige Gründe veranlasste rückwirkende Gesetzesänderung" (BVerfGE 126, 369 [392]). | |
Dies gilt naturgemäß zunächst für den ersten hier zu nennenden Fall vom 23. Februar 1960, da das Gericht damals von einer lediglich "deklaratorischen Bedeutung" der gesetzlichen Klarstellung ausging (vgl. BVerfGE 10, 332 [340]). Man mag in jenem Fall nur eine geringe Parallele sehen, da der Senat hier anders als dort gerade nicht von einem lediglich deklaratorischen Gesetz ausgeht. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass auch damals die Rechtslage objektiv keinesfalls so klar war, wie die verfassungsgerichtliche Beurteilung des Gesetzes als "deklaratorisch" vermuten lässt: Die Frage, die der Gesetzgeber rückwirkend änderte, war damals vielmehr durchaus umstritten und noch das vorlegende Gericht war der Auffassung, dass das Gesetz die Rechtslage verändert habe. Nach den heute vom Senat zugrunde gelegten, differenzierteren Kriterien wäre deshalb wohl äußerst zweifelhaft, ob damals tatsächlich von einer bloß deklaratorischen Rechtsänderung die Rede sein konnte. Dennoch erkannte man damals nicht auf eine verfassungsrechtlich verbürgte Chance, fachgerichtlichen Rechtsschutz zu erlangen, sondern sah es als Befugnis des Gesetzgebers an, diese Frage selbst rückwirkend klarzustellen.
| |
Ebenso wurde eine rückwirkende Klärung in der Entscheidung zur Angestelltenversicherung vom 17. Januar 1979 als unbedenklich angesehen. Der Senat ließ dort ausdrücklich offen, ob die Gesetzesänderung deklaratorischen oder konstitutiven Charakter hatte. Es reichte ihm hier die Feststellung, dass "die ursprüngliche Norm ... von vornherein Anlass zu zahlreichen Auslegungsproblemen gegeben" habe, "deren Lösung nicht allein aus dem Wortlaut, sondern nur in einer Zusammenschau von Wortlaut, Entstehungsgeschichte, System und gesetzgeberischer Zielsetzung möglich war" (BVerfGE 50, 177 [194]). Der Bürger habe sich auf den durch die Norm erzeugten Rechtsschein deshalb nicht verlassen dürfen. Von den gesteigerten Anforderungen des Senats an | |
Besonders deutlich wird die Bewertungsverschiebung der Senatsmehrheit schließlich in Kontrast zu den beiden jüngeren Entscheidungen zur authentischen Auslegung. Im Fremdrentenbeschluss vom 21. Juli 2010 nahm der Senat sogar eine rückwirkende gesetzliche Klarstellung hin, die sich zu Lasten der Betroffenen über eine höchstrichterliche Grundsatzentscheidung hinwegsetzte. Das Vertrauen der betroffenen Rentner, unter leichteren Bedingungen eine Rente zu erhalten, war dort jedenfalls wesentlich gehaltvoller unterlegt als vorliegend das Vertrauen der Banken, ihre Verluste steuerlich geltend machen zu können: Das dort streitige Gesetz nahm den Betroffenen ganz erhebliche Aussichten, ihre Ansprüche im Prozesswege durchzusetzen. Als es in Kraft trat, hatte das Bundessozialgericht gerade in ihrem Sinne entschieden. Dennoch reichte dies dem Senat nicht, um dem Gesetzgeber eine rückwirkende Klarstellung zu untersagen. Von einem Reservat der Rechtsprechung, unklare Rechtslagen selbst aufzulösen, war hier nicht die Rede. Vielmehr stellte der Senat konsequent auf die Frage des Vertrauensschutzes ab: Selbst eine höchstrichterliche Klärung reiche nicht in jedem Fall, ein Vertrauen in die entsprechende Rechtslage zu begründen (vgl. BVerfGE 126, 369 [394 ff.]).
| |
Nicht anders lag es bei der Entscheidung des Senats vom 2. Mai 2012 zur Beamtenversorgung. Auch dort setzte sich der Gesetzgeber über eine letztinstanzliche Auslegung eines Bundesgerichts – in concreto des Bundesverwaltungsgerichts – hinweg und führte damit für die Betroffenen rückwirkend eine ungünstigere Versorgungsregelung herbei. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte dies. Wiederum wurde als maßgebliches Kriterium das Vertrauen in die geltende Rechtslage zugrunde gelegt. Nur wenn die Rechtslage generell geeignet sei, ein Vertrauen zu begründen und darauf gegründete Entscheidungen – insbesondere Vermögensdispositionen – herbeizuführen, sei ein solches Vertrauen berechtigt (vgl. BVerfGE 131, 20 [41]). Selbst höchstrichterliche Entscheidungen würden ein solches Vertrauen nicht automatisch begründen. Es | |
c) Vergleicht man all diese Fälle mit der vorliegenden Konstellation, in der die Rechtslage sogar noch höchstrichterlich ungeklärt, zwischen Literatur und Fachgerichtsbarkeit vielfältig umstritten und damit insgesamt in jeder Hinsicht als offen bezeichnet werden kann, wird offensichtlich, dass ein Vertrauensschutz im vorliegenden Verfahren nach den Kriterien der bisherigen Rechtsprechung nicht ansatzweise begründet ist. Auch vom Gegenstand her gibt es keinen Grund, warum das Vertrauen von Banken in die teilweise Abwälzbarkeit ihrer Verluste auf die Allgemeinheit weitergehend geschützt sein soll als das Vertrauen von Rentnern oder Beamten in eine für sie günstige Berechnung ihrer Bezüge. Der Senat vollzieht mit dieser Entscheidung vielmehr eine grundlegende Umwertung der bisherigen Maßstäbe.
| |
3. Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass ein konsequentes Abstellen auf das Vertrauenskriterium den Grundsatz des Verbots echt rückwirkender Gesetze letztlich schon als solchen hinfällig werden ließe und damit seinerseits die Schutzstandards der Rechtsprechung preisgebe.
| |
Dass diese Schutzstandards jedenfalls bisher nicht in der nun vom Senat zugrunde gelegten Strenge praktiziert wurden und das grundsätzliche Verbot echt rückwirkender Gesetze, auch mittels der von der Rechtsprechung zugleich entwickelten Ausnahmemöglichkeiten, letztlich zu einer maßgeblichen Berücksichtigung von Vertrauensgesichtspunkten führte, hat die Durchsicht der Rechtsprechung deutlich gemacht. Die Unterscheidung zwischen echter und unechter Rückwirkung wurde in ihr weniger als kategoriale denn als heuristische Unterscheidung verstanden – was sich mit dieser Entscheidung ändert.
| |
Durch ein konsequentes Abstellen auf den Vertrauensschutz | |
IV.
| |
Die streitbefangenen Normen geben auch sachlich keinen Anlass, hier von einem Vertrauen der klagenden Banken in die steuerrechtliche Berücksichtigung ihrer Verluste auszugehen. Dass eine solche Berücksichtigung mit der alten Regelung des § 40a Abs. 1 KAGG nie intendiert war, ist bei sachgerechter Auslegung jedenfalls naheliegend. Ganz unzweifelhaft ist jedenfalls, dass die Kläger mit einer solchen Auslegung rechnen mussten und auf ein entgegenstehendes Verständnis keine Dispositionen stützen konnten. | |
Zwar verweist der Wortlaut des § 40a Abs. 1 KAGG a.F. ausdrücklich nur auf § 8b Abs. 2 KStG a.F., der die steuerliche Nichtberücksichtigung der Gewinne anordnet, nicht aber auch auf dessen Abs. 3, der die Nichtberücksichtigung der Verluste regelt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass dieser Verweis möglicherweise doch weiter zu verstehen ist. Gerade in komplexen Materien wie dem Steuerrecht, in denen nicht jeder Fall vom Gesetzgeber vorgedacht werden kann, ist es Aufgabe der Fachgerichtsbarkeit, die Normen nicht in einer punktuell beziehungslosen Wortlautauslegung zu exekutieren, sondern sie aus ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Systematik und den gesetzgeberischen Leitideen heraus zu interpretieren, mit Sinn zu füllen und rechtsfortbildend weiter zu entwickeln. Die strengen Grenzen des Art. 103 Abs. 2 GG, die für den besonderen Bereich des Strafrechts im Zweifel alle Unklarheiten zugunsten des Bürgers durchschlagen lassen, gelten hier nicht. Die Rechtsprechung hat vielmehr den im Gesetz angelegten Ausgleich von privaten und öffentlichen Interessen in einer beiden Seiten gerecht werdenden Weise fortzudenken und ihm Gestalt zu geben. Insofern steht der Wortlaut einer Auslegung, die bei verständiger Würdigung aller Gesichtspunkte schon in der ursprünglichen Fassung des § 40a Abs. 1 KAGG einen impliziten Verweis nicht nur auf § 8b Abs. 2 KStG a.F., sondern auch auf Abs. 3 KStG a.F. sieht, nicht entgegen. Eine solche Auslegung kommt auch nicht erst dann in Betracht, wenn sich anders unerträgliche Wertungswidersprüche auftun. Maßgeblich ist vielmehr, welches Verständnis sich nach Maßgabe der allgemeinen juristischen Auslegungsmethoden als das in der Sache überzeugendste und dem mutmaßlichen Willen des damaligen Gesetzgebers am nächsten kommende erweist.
| |
a) Die Einfügung des § 40a Abs. 1 KAGG a.F. erfolgte im Gesamtzusammenhang mit der Umstellung des Körperschaftsteuerrechts vom Anrechnungsverfahren auf das Halbeinkünfteverfahren. Man wollte dabei auch die Investmentfonds möglichst systemgerecht in die neue Ordnung einbeziehen. Ausgehend von der Grundidee des § 8b KStG a.F. und in Verbindung mit dem für die Investmentfonds leitenden Transparenzprinzip liegt es insoweit nahe, dass hier Veräußerungsgewinne und -verluste ebenso wie Teilwertab- und -zuschreibungen möglichst systemgerecht, und das heißt gleichförmig und symmetrisch, in das Körperschaftsteuerrecht integriert werden sollten.
| |
Der Gesetzgeber hat in den Materialien keinerlei Erklärung erkennen lassen, warum hier unter Abweichung von der Grundkonzeption des § 8b KStG a.F. nur dessen Abs. 2 anwendbar sein soll. Die Erläuterungen weisen die Einführung der §§ 38 ff. KAGG lediglich als Konsequenz der Gesetzesreform aus (vgl. BTDrucks 14/2683, S. 132) und erläutern die spätere Einfügung des § 40a KAGG a.F. nur in einzelnen technischen Aspekten (vgl. BTDrucks 14/3366, S. 126). Hiervon ausgehend spricht wenig dafür, dass mit der Regelung systemwidrig eine Abweichung vom Transparenzprinzip statuiert werden sollte. Zwar darf der Rückgriff auf das Transparenzprinzip in der Tat nicht genutzt werden, um mit systematischen Erwägungen anderweitige Entscheidungen des Gesetzgebers zu überspielen. Das Transparenzprinzip gilt nur insoweit, als der Gesetzgeber hierauf rekurriert (vgl. BFHE 130, 287 [289]; 229, 351 [357]; Schnitger/Schachinger, BB 2007, S. 801). Wenn aber der Gesetzgeber durch nichts zu erkennen gibt, dass ihn irgendwelche Sachgründe angeleitet haben, hier zu anderen Regeln zu greifen, spricht schon dies dafür, hierin eher ein Redaktionsversehen zu sehen als eine bewusste anderweitige Entscheidung.
| |
Ein Indiz für ein gesetzgeberisches Redaktionsversehen lässt sich bei genetischer Auslegung im Übrigen auch daraus herleiten, | |
b) Auch in der Sache ist wenig wahrscheinlich, dass der Gesetzgeber Gewinne aus Anteilen an Investmentfonds von Steuern freistellen wollte, hiermit verbundene Verluste aber steuermindernd anerkennen wollte. Ein Hinweis darauf, dass eine solche steuerliche Form der Privatisierung von Gewinnen bei gleichzeitiger Sozialisierung der Verluste gewollt war, ist nicht ersichtlich, und Sachgründe hierfür sind nicht erkennbar. Allerdings weist das vorlegende Gericht zu Recht darauf, dass für die im konkreten Fall in Frage stehenden Teilwertabschreibungen der Wertungswiderspruch durch § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG a.F. ein Stück weit abgemildert wird. Diese Vorschrift führt dazu, dass Gewinne und Verluste so miteinander verrechnet werden, dass jedenfalls eine doppelte Begünstigung verhindert wird, die dadurch entstehen könnte, dass in einem Jahr erzielte Gewinne steuerfrei bleiben, entsprechende Verluste im nächsten Jahr aber steuermindernd berücksichtigt werden könnten. Dennoch ändert dies nichts an der bei wörtlicher Anwendung der Norm verbleibenden Asymmetrie, dass im Gesamtergebnis die bei Veräußerung erzielten Gewinne steuerfrei sind, während Verluste zu Lasten der Allgemeinheit steuerlich in Ansatz gebracht werden können. Der Verweis auf § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG a.F. führt zu einer Verrechnung nur bezogen auf den jeweiligen Anteil und hilft bei den nur ein | |
All diese Verkomplizierungen lösen sich auf, wenn man systematisch folgerichtig § 40a Abs. 1 KAGG a.F. von vornherein so versteht, dass er schon immer nicht nur auf Abs. 2, sondern auch auf Abs. 3 verwiesen hat – wie ja im Übrigen auch unstreitig ist, dass der gleichfalls nicht vom Wortlaut umfasste Abs. 4 anwendbar ist.
| |
c) Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, diese Frage abschließend zu klären. Dies wird – in Folge der Mehrheitsmeinung im Senat – nun Aufgabe der Fachgerichte sein. Angesichts der triftigen Argumente, die schon ursprünglich für die Auslegung sprachen, die der Gesetzgeber dann auch ausdrücklich bekräftigt hat, kann die rückwirkende Erstreckung dieser Regelung auf die offen gebliebenen Altfälle dann aber nicht als Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes beurteilt werden. Die klagenden Banken mussten von Anfang an damit rechnen, dass sie ihre Teilwertabschreibungen nicht steuermindernd geltend machen können. Das gilt umso mehr, als die hier in Frage stehenden Auslegungsfragen schon früh bekannt waren und in der Regel Unternehmen, insbesondere Banken mit kompetenten Rechtsabteilungen, betreffen, die solche Unklarheiten im Zweifel schneller erkennen als die Finanzbehörden selbst.
| |
3. Dass der Gesetzgeber in dieser Lage nicht selbst auch für die Altfälle eine Regelung treffen darf, leuchtet nicht ein. Die Annahme eines prinzipiellen Reservats der Fachgerichtsbarkeit für die Lösung dieser Fälle überzeugt – wie dargelegt – schon grundsätzlich nicht. Wenig einleuchtend sind aber auch die vom Senat ergänzend herangezogenen Abgrenzungskriterien für die Anerkennung von Ausnahmen.
| |
a) Eine rückwirkende Regelung soll nach Ansicht des Senats | |
b) Die für den Senat maßgebliche Abgrenzung zwischen einer ungeklärten Rechtslage, die ein rückwirkendes Gesetz noch nicht rechtfertigt, und unklarer und verworrener Rechtslage, die ein solches Gesetz rechtfertigen kann, ist eine Wertungsfrage, die für künftige Fälle Spielräume belässt. Es ist zu hoffen, dass hierüber der mit vorliegender Entscheidung vom Senat eingeschlagene Irrweg doch wieder eingefangen werden kann und sich diese Entscheidung dann im Rückblick nur als Einzelfall darstellt.
| |
Gerade aber wenn sie nur ein Einzelfall bleibt, muss die Entscheidung auf Widerspruch stoßen. Denn der vorliegende Fall gibt zu einem Abweichen von der Rechtsprechung besonders wenig Anlass: Es geht hier um das Vertrauen insbesondere von Banken in die steuerliche Absetzbarkeit von Verlusten in einem Geschäftsbereich, der insgesamt durch einen spekulativen Charakter geprägt ist. Praktisch dürfte es in den betroffenen Jahren vor allem auch um die Verluste in Folge der durch die Anschläge des 11. September 2001 ausgelösten Kursstürze gehen. Warum nun ausgerechnet in dieser Konstellation strengere Anforderungen an den Gesetzgeber gestellt werden als in den Fällen, in denen es um den Zugang zur Angestelltenversicherung, die Erlangung von Renten oder die Höhe der Beamtenversorgung ging, leuchtet nicht ein. | |
Richtigerweise hätte § 43 Abs. 18 KAGG für verfassungsgemäß erklärt werden müssen. Dabei ist es wenig wichtig, ob man angesichts der ungeklärten Auslegung des § 40a Abs. 1 KAGG a.F. schon das Vorliegen einer änderungsfähigen Rechtslage und damit überhaupt einer Rückwirkung verneint, ob man von einer nur formellen Rückwirkung ausgeht, die durch die ungeklärte Rechtslage gerechtfertigt ist (vgl. BVerfGE 126, 369 [393 ff.]), oder ob man hier eine Rückwirkung sieht, die jenseits der Alternativen von echter und unechter Rückwirkung oder deklaratorischer oder konstitutiver Rechtsänderung unmittelbar durch Verweis auf die offene Rechtsfrage zu lösen ist (vgl. BVerfGE 50, 177 [193 f.]; 131, 20 [40 ff.]). Maßgeblich ist allein, dass im Ergebnis auf die Frage abgestellt werden muss, in welchem Umfang die bisherige Rechtslage ein berechtigtes Vertrauen begründet hat. Und ein solches Vertrauen besteht im vorliegenden Fall schlicht nicht.
| |
Nur durch ein konsequentes Abstellen auf ein berechtigtes Vertrauen in die bestehende Rechtslage behält die Rückwirkungsrechtsprechung ihren Charakter als Schutz individueller Freiheit und Selbstbestimmung. Mit der vorliegenden Entscheidung verformt der Senat die Rückwirkungsrechtsprechung zu einem Instrument der Absicherung eines Reservats der Rechtsprechung. Der Gesetzgeber wird aus seiner Verantwortung gedrängt und der Bereich politisch-parlamentarischer Entscheidung ungerechtfertigt eingeengt. Dies entspricht dem Bild der Demokratie des Grundgesetzes nicht.
| |