Abruf und Rang:
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang: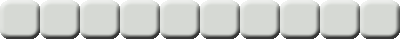 80% (656)
80% (656)
Zitiert durch:
BVerfGE 118, 1 - Begrenzung der Rechtsanwaltsvergütung
BVerfGE 113, 29 - Anwaltsdaten
BVerfGE 110, 226 - Geldwäsche
BVerfGE 108, 150 - Sozietätswechsel
BVerfGE 103, 1 - Singularzulassung zum OLG
BVerfGE 93, 213 - DDR-Rechtsanwälte
BVerfGE 76, 171 - Standesrichtlinien
BVerfGE 75, 40 - Privatschulfinanzierung I
BVerfGE 72, 51 - Bundesrechtsanwaltsordnung
Zitiert selbst:
BVerfGE 59, 128 - Bekenntnis zum deutschen Volkstum
BVerfGE 50, 16 - Mißbilligende Belehrungen
BVerfGE 49, 304 - Sachverständigenhaftung
BVerfGE 47, 198 - Wahlwerbesendungen
BVerfGE 47, 130 - KBW-Werbung
BVerfGE 41, 251 - Speyer-Kolleg
BVerfGE 40, 287 - Verfassungsschutzbericht
BVerfGE 39, 334 - Extremistenbeschluß
BVerfGE 38, 105 - Rechtsbeistand
BVerfGE 37, 67 - Prozeßfähigkeit des Anwalts
BVerfGE 34, 293 - Ensslin-Kassiber
BVerfGE 30, 1 - Abhörurteil
BVerfGE 28, 51 - Flugblätter
BVerfGE 28, 36 - Zitiergebot
BVerfGE 26, 186 - Ehrengerichte
BVerfGE 25, 88 - Berufsverbot II
BVerfGE 25, 44 - Durchsetzung von Parteiverboten
BVerfGE 25, 1 - Mühlengesetz
BVerfGE 23, 98 - Ausbürgerung I
BVerfGE 22, 114 - Entziehung der Verteidigungsbefugnis
BVerfGE 19, 330 - Sachkundenachweis
BVerfGE 18, 85 - Spezifisches Verfassungsrecht
BVerfGE 15, 226 - Verteidigungsbefugnis
BVerfGE 13, 123 - Fragestunde
BVerfGE 13, 97 - Handwerksordnung
BVerfGE 12, 296 - Parteienprivileg
BVerfGE 10, 118 - Berufsverbot I
BVerfGE 7, 377 - Apotheken-Urteil
BVerfGE 6, 32 - Elfes
BVerfGE 5, 85 - KPD-Verbot
RTF-Version (Seiten, Linien), Druckversion (Seiten)
Rang:
Zitiert durch:
BVerfGE 118, 1 - Begrenzung der Rechtsanwaltsvergütung
BVerfGE 113, 29 - Anwaltsdaten
BVerfGE 110, 226 - Geldwäsche
BVerfGE 108, 150 - Sozietätswechsel
BVerfGE 103, 1 - Singularzulassung zum OLG
BVerfGE 93, 213 - DDR-Rechtsanwälte
BVerfGE 76, 171 - Standesrichtlinien
BVerfGE 75, 40 - Privatschulfinanzierung I
BVerfGE 72, 51 - Bundesrechtsanwaltsordnung
Zitiert selbst:
BVerfGE 59, 128 - Bekenntnis zum deutschen Volkstum
BVerfGE 50, 16 - Mißbilligende Belehrungen
BVerfGE 49, 304 - Sachverständigenhaftung
BVerfGE 47, 198 - Wahlwerbesendungen
BVerfGE 47, 130 - KBW-Werbung
BVerfGE 41, 251 - Speyer-Kolleg
BVerfGE 40, 287 - Verfassungsschutzbericht
BVerfGE 39, 334 - Extremistenbeschluß
BVerfGE 38, 105 - Rechtsbeistand
BVerfGE 37, 67 - Prozeßfähigkeit des Anwalts
BVerfGE 34, 293 - Ensslin-Kassiber
BVerfGE 30, 1 - Abhörurteil
BVerfGE 28, 51 - Flugblätter
BVerfGE 28, 36 - Zitiergebot
BVerfGE 26, 186 - Ehrengerichte
BVerfGE 25, 88 - Berufsverbot II
BVerfGE 25, 44 - Durchsetzung von Parteiverboten
BVerfGE 25, 1 - Mühlengesetz
BVerfGE 23, 98 - Ausbürgerung I
BVerfGE 22, 114 - Entziehung der Verteidigungsbefugnis
BVerfGE 19, 330 - Sachkundenachweis
BVerfGE 18, 85 - Spezifisches Verfassungsrecht
BVerfGE 15, 226 - Verteidigungsbefugnis
BVerfGE 13, 123 - Fragestunde
BVerfGE 13, 97 - Handwerksordnung
BVerfGE 12, 296 - Parteienprivileg
BVerfGE 10, 118 - Berufsverbot I
BVerfGE 7, 377 - Apotheken-Urteil
BVerfGE 6, 32 - Elfes
BVerfGE 5, 85 - KPD-Verbot
2. Die geltende gesetzliche Zulassungsregelung schließt es aus, ein aktives Eintreten für eine als verfassungsfeindlich angesehene Partei nachteilig mitzuberücksichtigen, wenn der Bewerber die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht in strafbarer Weise im Sinne des § 7 Nr. 6 der Bundesrechtsanwaltsordnung bekämpft.
| |
Beschluß | |
des Ersten Senats vom 8. März 1983
| |
| – 1 BvR 1078/80 – | |
in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde des Assessors D ... – Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Henning Plähn und Ingeborg Eisele, Hildesheimer Straße 52 A, Hannover l – gegen den Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 30. Juni 1980 – AnwZ (B) 6/80 –.
| |
Entscheidungsformel: | |
Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Beschwerdeführer die notwendigen Auslagen zu erstatten.
| |
Gründe: | |
A. | |
Der Beschwerdeführer beanstandet, daß bei der Entscheidung über seine Zulassung zur Rechtsanwaltschaft sein Eintreten für eine als verfassungsfeindlich angesehene Partei zu seinem Nachteil mitberücksichtigt worden sei.
| |
I.
| |
1. Nach der später mehrfach geänderten Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) vom 1. August 1959 (BGBl. I S. 565) ist der Rechtsanwalt "ein unabhängiges Organ der Rechtspflege" (§ 1). Er "übt einen freien Beruf aus. Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe" (§ 2). "Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten" (§ 3 Abs. 1). Neben den Vorschriften über die Stellung des Rechtsanwalts enthält das Gesetz auch eine Gewährleistung der freien Anwaltswahl für jedermann (§ 3 Abs. 3).
| |
Alsbald nach seiner ersten Zulassung hat der Rechtsanwalt in einer öffentlichen Gerichtssitzung folgenden Eid zu leisten:
| |
§ 26
| |
(1)... Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. (2)-(5) ... | |
Leistet der Rechtsanwalt den Eid nicht binnen dreier Monate nach der Zulassung, kann diese zurückgenommen werden (§ 35 Abs. 1 Nr. 1; § 14 Abs. 1 Nr. 7). Über die Berufspflichten enthält das Gesetz folgende Generalklausel: | |
Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. Er hat sich innerhalb und außerhalb des Berufes der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu erweisen.
| |
2. Der Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft darf nur aus den in der Rechtsanwaltsordnung bezeichneten Gründen abgelehnt werden (§ 6). Zu diesen Gründen gehören:
| |
§ 7
| |
Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist zu versagen, 1. wenn der Bewerber nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Grundrecht verwirkt hat; 2.-4. ... 5. wenn der Bewerber sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das ihn unwürdig erscheinen läßt, den Beruf eines Rechtsanwalts auszuüben; 6. wenn der Bewerber die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft; 7.-10. ... | |
Über den Zulassungsantrag entscheidet die Landesjustizverwaltung, die zuvor ein Gutachten des Vorstandes der örtlich zuständigen Rechtsanwaltskammer einholt (§ 8). Macht dieser einen Versagungsgrund nach den Nummern 5 bis 8 des § 7 geltend, setzt die Landesjustizverwaltung das Zulassungsverfahren aus und überläßt es dem Bewerber, eine gerichtliche Entscheidung des Ehrengerichtshofs für Rechtsanwälte herbeizuführen. Stellt dieser fest, daß der von der Rechtsanwaltskammer angeführte Versagungsgrund vorliegt, kann der Bewerber dagegen sofortige Beschwerde an den Bundesgerichtshof einlegen; verneint der Ehrengerichtshof den Versagungsgrund, steht der Rechtsanwaltskammer und ebenfalls der Landesjustizverwaltung die sofortige Beschwerde zu (§§ 9, 37 ff.).
| |
3. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlischt, wenn durch ein rechtskräftiges Urteil auf Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft erkannt ist (§ 13). Diese Ausschließung ist | |
In einem Vorlageverfahren (1 BvL 8/77), das mit der vorliegenden Verfassungsbeschwerde zunächst verbunden war, hatte ein Ehrengericht den Standpunkt vertreten, eine Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft komme auch dann in Betracht, wenn ein Rechtsanwalt die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpfe. Ob sich die Pflicht zur Verfassungstreue bereits aus der Organstellung der Rechtsanwaltschaft ergebe, die ihn vielfach in die Nähe eines öffentlichen Amtes rücke, könne dahinstehen. Jedenfalls verpflichte die Eidesvorschrift des § 26 Abs. 1 BRAO, die mit dem Grundgedanken der "streitbaren Demokratie" übereinstimme, den Rechtsanwalt zur Wahrung der verfassungsmäßigen Ordnung; der Begriff des Wahrens schließe jede verfassungsfeindliche Tätigkeit auch außerhalb der Berufsausübung und in nicht strafbarer Weise aus. Soweit indessen die gesetzliche Regelung eine Ausschließung wegen Verletzung dieser Pflicht rechtfertige und gebiete, sei sie mit Art. 18 und Art. 21 Abs. 2 GG unvereinbar und teilnichtig.
| |
II.
| |
1. Der Beschwerdeführer, der Ende 1975 die Zweite Juristische Staatsprüfung bestanden hatte und Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) ist, erstrebt seine Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Ab Frühjahr 1976 war er für die Dauer eines Jahres Aushilfsangestellter beim Arbeits | |
Der Vorstand der zuständigen Rechtsanwaltskammer machte in seinem Gutachten vom 10. August 1978 sowie in zwei während des gerichtlichen Verfahrens erstellten Ergänzungsgutachten vom 24. Januar 1978 und vom 16. Mai 1978 den Versagungsgrund der Unwürdigkeit geltend. Im ersten Ergänzungsgutachten stellte er klar, seine ablehnende Stellungnahme werde nicht auf die politische Gesinnung und Tätigkeit des Beschwerdeführers gestützt. Im ersten Gutachten hatte der Kammervorstand vor allem auf zwei strafgerichtliche Verurteilungen des Beschwerdeführers hingewiesen: Dieser hatte sich an der Störung einer Veranstaltung im Auditorium Maximum der Universität Kiel beteiligt und war durch Urteil vom 5. Juli 1974 wegen gemeinschaftlicher Verstöße gegen § 21 VersG in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt worden, deren Verbüßung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dieser Vorfall reichte nach Meinung des Kammervorstandes für ein negatives Gutachten wohl nicht aus, weil der Beschwerdeführer zur Tatzeit noch Student (richtig: Referendar) gewesen sei und ihm Zeugenaussagen ein beschwichtigendes Verhalten bescheinigt hätten. Noch während der Bewährungszeit hatte sich der Beschwerdeführer aber Anfang 1976 als Assessor an Protestdemonstrationen gegen Fahrpreiserhöhungen in Oldenburg beteiligt, bei denen Linienbusse zweimal für etwa 25 Minuten an der Weiterfahrt gehindert wurden. Er wurde deshalb wegen gemeinschaftlicher Nötigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 DM verurteilt, wobei ihm zugute gehalten wurde, daß er schlichtend, ordnend und ausgleichend auf die Demonstranten eingewirkt habe. Die Annahme der Strafkammer, der Beschwerdeführer habe zu keiner Zeit dem KBW | |
Neben den Verurteilungen hatte der Kammervorstand namentlich in den Ergänzungsgutachten noch eine Reihe weiterer Vorkommnisse genannt, welche die mangelnde Bereitschaft des Beschwerdeführers zeigten, die für die Ausübung des Anwaltsberufs notwendigen Spielregeln zu beachten. Von diesen erlangten in dem späteren ehrengerichtlichen Verfahren nur die folgenden Bedeutung: In dem zweiten gegen ihn durchgeführten Strafverfahren habe sich der Beschwerdeführer bei Störungen der erstinstanzlichen Verhandlung besonders hervorgetan. Im Dezember 1978 habe er sich an einer verbotenen Demonstration des KBW in Kiel beteiligt. Schließlich sei er für Abfassung und Versendung einer Resolution mehrerer Rechtsanwälte und Assessoren im November 1978 mitverantwortlich, die zu seinen Gunsten verfaßt worden sei und in der es heiße:
| |
Wir sind gegen alle Versuche, die Rechtsanwälte dem Erfordernis der Staatstreue zu unterwerfen und damit die Zulassung vom politischen Wohlverhalten abhängig zu machen. Der Anwalt muß seinen Beruf frei von jeder politischen Bindung an diese Staatsordnung ausüben können.
| |
2. Schon nach Erstattung des ersten Gutachtens setzte der Justizminister die Entscheidung über den Zulassungsantrag des Beschwerdeführers aus, um diesem Gelegenheit zur ehrengerichtlichen Klärung zu geben.
| |
a) Der Ehrengerichtshof für Rechtsanwälte stellte nach Vernehmung zahlreicher Zeugen in seinem Beschluß vom 17. Dezember 1979 fest, daß der in den drei Gutachten geltend gemachte Versagungsgrund der Unwürdigkeit nicht vorliege.
| |
Die den beiden Verurteilungen zugrunde liegenden politisch motivierten Handlungen des Beschwerdeführers seien zwar mehr als bloße Jugendsünden, reichten aber nicht aus, um ihn | |
Der Beschwerdeführer habe sich auf Befragen ausdrücklich bereiterklärt, den vorgeschriebenen Eid zu leisten. Zweifel daran, ob er wirklich bereit sei, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren, könnten sich aus seiner politischen Einstellung, insbesondere einer etwaigen Mitgliedschaft im KBW ergeben. Damit habe aber der Kammervorstand seine Bedenken nicht begründet, so daß kein Anlaß bestehe, dieser Frage nachzugehen. Der Versagungsgrund der Unwürdigkeit wolle in erster Linie die Wahrung der Mandanteninteressen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität des Anwaltsstandes schützen. Die etwaige Bekämpfung der verfassungsmäßigen Ordnung falle unter den Versagungsgrund des § 7 Nr. 6 BRAO; dieser sei auch eher berührt, soweit die strafrechtlich relevanten Handlungen des Beschwerdeführers politisch motiviert seien. Auf diesen Versagungsgrund sei aber das Gutachten des Kammervorstandes ausdrücklich nicht gestützt.
| |
b) Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof auf die sofortige Beschwerde der Rechtsanwaltskammer und des Justizministers durch den angegriffenen Beschluß vom 30. Juni 1980 (BGHZ 77, 331 = NJW 1980, S. 2711) aufgehoben. Er hat den Antrag des Beschwerdeführers auf gerichtliche Entscheidung zurückgewiesen und festgestellt, daß der vom Vorstand der Rechtsanwaltskammer angeführte Versagungsgrund der Unwürdigkeit vorliege.
| |
Seiner Entscheidung stellt der Bundesgerichtshof den Leitsatz voran: "Im Rahmen der Gesamtwürdigung nach § 7 Nr. 5 BRAO kann ein aktives Eintreten des Bewerbers für eine ver | |
Unter ausführlicher Darlegung und Würdigung des dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Verhaltens führt der Bundesgerichtshof aus, der Beschwerdeführer habe insgesamt eine seit Jahren bestehende feindliche Einstellung gegen die rechtliche und verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik erkennen lassen und sich rücksichtslos über diese Ordnung hinweggesetzt. Als gewichtiges Beweisanzeichen dafür, daß weder die Berufspflichten des Rechtsanwalts noch der zu leistende Eid den Beschwerdeführer zur Änderung seiner auf politischer Überzeugung beruhenden rechtsfeindlichen Einstellung veranlassen würden und daß er deshalb nach seinem gesamten Verhalten für den Anwaltsstand nicht tragbar sei, dürfe – das habe der Ehrengerichtshof verkannt – auch gewertet werden, daß der Beschwerdeführer als Mitglied des KBW die verfassungsfeind | |
Bei der rechtlichen Würdigung der aktiven Unterstützung des KBW geht der Bundesgerichtshof davon aus, daß darin ein Versagungsgrund nach § 7 Nr. 6 BRAO schon deshalb nicht gesehen werden könne, weil die Rechtsanwaltskammer diesen Grund nicht geltend mache. Durch die genannte Vorschrift werde aber auch nicht der Versagungsgrund der Unwürdigkeit eingeschränkt. Ob die aktive Mitgliedschaft im KBW im Hinblick auf die staatliche Gebundenheit des Rechtsanwaltsberufs für sich allein als Grund für die Zulassungsversagung wegen Unwürdigkeit herangezogen werden dürfe, brauche nicht entschieden zu werden. Soweit die in der aktiven Förderung der Partei sich offenbarende feindliche Einstellung des Beschwerdeführers gegen die rechtliche und staatliche Ordnung der Bundesrepublik die tatsächliche Würdigung seines festgestellten Fehlverhaltens mitbeeinflusse, handele es sich um die Auswirkung des allgemeinen Rechtssatzes, daß es für die Prüfung der Unwürdigkeit auf die Gesamtpersönlichkeit des Bewerbers ankomme.
| |
Der Berücksichtigung der aktiven Unterstützung des KBW stehe das Parteienprivileg des Art. 21 GG nicht entgegen. Die Feststellung des geltend gemachten Versagungsgrundes richte sich nach dem standesrechtlichen Sinn und Zweck des § 7 Nr. 5 BRAO weder gegen Bestand und Tätigkeit des KBW noch gegen die mit der Partei zusammenhängende Tätigkeit des Beschwerdeführers; beides werde davon nicht gezielt betroffen. Von der Gesamtpersönlichkeit eines Bewerbers lasse sich seine politische Auffassung, die auf Umsturz und bewaffneten Auf | |
3. Gegen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat der Beschwerdeführer Verfassungsbeschwerde eingelegt, mit der er eine Verletzung seiner Grundrechte aus Art. 12 und Art. 5 GG sowie seiner Rechte auf Freiheit der parteipolitischen Betätigung und der Ausübung staatsbürgerlicher Rechte (Art. 20 Abs. 2 i. V. m. Art. 33 Abs. 1, Art. 21 Abs. 2 GG) rügt.
| |
Von den ursprünglich in den Gutachten der Anwaltskammer zusammengetragenen Vorwürfen hätten sich in der Beweisaufnahme vor dem Ehrengerichtshof die meisten als haltlos erwiesen. Insbesondere sei von einem pflichtwidrigen Verhalten während des mehrjährigen Auftretens des Beschwerdeführers als Prozeßvertreter nichts übrig geblieben. Die fünf restlichen, teils lange zurückliegenden Vorfälle würden in der angegriffenen Entscheidung teils unzutreffend, teils unzureichend gewürdigt; für den Vorwurf der Rücksichtslosigkeit bleibe der Bundesgerichtshof die Begründung schuldig. Um dem Beschwerdeführer eine rechtsfeindliche Grundeinstellung nachzuweisen, werde ihm seine Betätigung für den KBW durch Wahrnehmung des verfassungsrechtlich garantierten Wahlrechts zur Last gelegt. Wie der amtliche Leitsatz bestätige, würden für die Zulassung zur Anwaltschaft im Kern und trotz einiger Abgrenzungsversuche beamtenmäßige Treuepflichten | |
III.
| |
Zur Verfassungsbeschwerde haben sich der Bundesminister der Justiz namens der Bundesregierung, der Bayerische Ministerpräsident, der Vorstand der Schleswig-Holsteinischen Anwaltskammer als Beteiligter des Ausgangsverfahrens sowie mehrere Anwaltsverbände geäußert. In den Äußerungen wird teilweise auf die zum Vorlageverfahren 1 BvL 8/77 abgegebenen Stellungnahmen Bezug genommen.
| |
1. Der Bundesminister der Justiz hat sich lediglich zur Auslegung der Versagungsgründe geäußert. Aus den Gesetzesmaterialien zu § 7 Nr. 6 BRAO, insbesondere aus der im Laufe der Beratungen eingefügten Einschränkung "in strafbarer Weise" sei ersichtlich, daß politische Meinungsäußerungen allein keinesfalls zur Versagung der Zulassung ausreichten. Das sei nicht nur bei der Auslegung der Nr. 6, sondern auch bei der Anwendung der Nr. 5 (Unwürdigkeit) sowie für das Verhältnis beider Versagungsgründe zu beachten. Zwar könnten mit Rechtsprechung und Schrifttum die Nummern 5 und 6 des § 7 als voneinander unabhängige Versagungsgründe gewertet werden. Doch dürfe die in Nr. 6 errichtete Schranke nicht dadurch | |
2. Der Bayerische Ministerpräsident hält die Verfassungsbeschwerde für unbegründet.
| |
Als Organ der Rechtspflege, die ein überragendes Gemeinschaftsgut sei, habe der Rechtsanwalt mannigfache Rechte, die es auch aus dem Gesichtspunkt des öffentlichen Wohls zwingend erforderten, daß er zur Wahrung der verfassungsmäßigen Ordnung und zur Respektierung der geltenden Gesetze verpflichtet werde. Der Versagungsgrund der Unwürdigkeit stelle eine verfassungsrechtlich unbedenkliche subjektive Zulassungsbeschränkung im Sinne des Art. 12 Abs. 1 GG dar. Zuzustimmen sei der Auffassung des Bundesgerichtshofs, daß die Nr. 6 des § 7 BRAO nicht die nach Nr. 5 erforderliche Würdigung der Gesamtpersönlichkeit eines Bewerbers einschränke. Im Rahmen dieser Gesamtwürdigung dürften bestimmte konkrete – auch politisch motivierte – Verhaltensweisen berücksichtigt werden, die auf eine Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet seien. Deren Berücksichtigung unter dem Gesichtspunkt der Rechtsfeindlichkeit werde nicht dadurch verwehrt, daß ihnen eine bestimmte Gesinnung zugrunde liege.
| |
Auch Art. 5 GG, aus dem sich ein grundsätzliches Recht auf freie politische Betätigung ergebe, sei nicht verletzt. Dem Beschwerdeführer werde weder faktisch noch rechtlich die Äußerung und Verbreitung einer bestimmten Meinung untersagt. Das Parteienprivileg des Art. 21 Abs. 2 GG habe den normalen Status des politischen Aktivbürgers vor Augen, nicht dagegen den Bürger in seiner besonderen rechtlichen Stellung als Beamter oder Rechtsanwalt. Die Pflicht des einzelnen Anwalts, sich keines Verhaltens schuldig zu machen, das ihn für die Ausübung seines Berufs unwürdig erscheinen lasse, habe einen anderen rechtlichen Bezug als Art. 21 GG.
| |
3. Nach Ansicht des Vorstandes der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer hat der Bundesgerichtshof zu Recht den Versagungsgrund der Unwürdigkeit festgestellt. Dieser schränke das Grundrecht der Berufsfreiheit in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise ein. Die Verfassung und die sie konkretisierenden Regelungen des Beamtenrechts und der Bundesrechtsanwaltsordnung statuierten kein Berufsverbot. Sie stellten – wie das Bundesverfassungsgericht in der Radikalen-Entscheidung ausgeführt habe – nur legitime Zulassungsvoraussetzungen auf, die zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nötig seien und von jedem, der den Staatsdienst anstrebe oder Rechtsanwalt werden wolle, erfüllt werden könnten. Wer dem Staat dienen oder Rechtsanwalt sein wolle, dürfe nicht gegen den Staat und seine Verfassungsordnung aufbegehren oder anrennen wollen. Wer Kommunist sei, möge Anwalt sein und werden; wer aber die verfassungsmäßige Grundordnung bekämpfe, könne kein Organ der Rechtspflege sein oder werden.
| |
4. Nach der im Vorlageverfahren mitgeteilten Auffassung des Vorstandes des Deutschen Anwaltvereins kann die bloße Zugehörigkeit zu einer vom Bundesverfassungsgericht nicht verbotenen Partei keinen Anlaß zu Disziplinarmaßnahmen gegen einen Rechtsanwalt geben. Vor allem müsse die Auffassung zurückgewiesen werden, der Rechtsanwalt stehe hinsichtlich der Anforderungen an seine Verfassungstreue dem Beamten nahe oder sei sogar denselben Anforderungen wie der Richter unterworfen. Dies folge aus Stellung und Funktion des Rechtsanwalts und werde durch Wortlaut, Entstehungsgeschichte und systematische Stellung der §§ 26 und 7 Nr. 6 BRAO bestätigt. Die Eidesvorschrift, die sich ersichtlich nur auf die berufliche Tätigkeit des Anwalts beziehe, müsse verfassungskonform im | |
Diese Auffassung bedeute keine Freizeichnung des Rechtsanwalts. Man müsse zunächst die bis heute unbeantwortet gebliebene Frage stellen, wie ein Rechtsanwalt in Ausübung seines Berufs die verfassungsmäßige Ordnung bekämpfen könne, ohne dabei gegen irgendwelche Strafgesetze zu verstoßen. Entscheidend sei die Erkenntnis, daß der Rechtsanwalt andere Aufgaben und Pflichten habe als der Richter und Staatsanwalt. Während diese unmittelbar dem Staat, seiner verfassungsmäßigen Ordnung und seinen Gesetzen verpflichtet seien und in ihrer Berufstätigkeit darauf bedacht sein müßten, sich im Kernbereich der jeweils anstehenden Rechtsfrage zu bewegen, gehöre es zu den Aufgaben des Rechtsanwalts, im Dienst seines Mandanten die äußersten Grenzen dieses Bereichs auszuloten. Nur mit dieser dem Richter und Staatsanwalt teilweise entgegengesetzten Aufgabe könnten Recht und verfassungsmäßige Ordnung lebendig und in steter Entwicklung gehalten werden. Im Prozeß des Gegen- und Miteinanders der Rechtsfindung verkörpere der Anwalt das kämpferisch-suchende, das stets die Grenzen der Freiheit ausmessende und damit den vollen Umfang der Freiheit bewahrende Element. Seine Grenze finde er dabei nur im Standesrecht und in den allgemeinen Strafgesetzen. Weder in seiner beruflichen Tätigkeit noch im Bereich der privaten Lebensgestaltung könne und dürfe er anderen Beschränkungen unterworfen sein.
| |
5. Auch andere Anwaltsverbände vertreten übereinstimmend die Auffassung, die Zulassung könne nur dann versagt und eine Ausschließung nur dann angeordnet werden, wenn die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft werde.
| |
a) Der Republikanische Anwaltsverein und dessen niedersächsischer Regionalverband "Freie Advokatur" halten die Verfassungsbeschwerde für begründet. Der Bundesgerichtshof verletze das Grundrecht der Berufsfreiheit, da für seine Aus | |
Abzulehnen sei die im Vorlageverfahren vom Präsidenten des Bundesgerichtshofs vertretene Auffassung, an die Verfassungstreue eines Rechtsanwalts seien die gleichen Anforderungen zu stellen wie beim Richter. Die zwischen beiden bestehenden Unterschiede hätten für die Freiheitlichkeit unseres Gemeinwesens große Bedeutung. Der mißdeutbare Begriff der "Organstellung" sei aus der nationalsozialistischen Ära übernommen, aber durch das Grundgesetz entscheidend verändert worden. In einem freiheitlichen Rechtsstaat, in dem die freie Advokatur auch nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung eine fundamentale objektive Bedeutung habe, sei der Anwalt unbedingt der Wahrer und Förderer von Mandanteninteressen, um Chancen- und Waffengleichheit herzustellen. Seine besonderen Befugnisse folgten nicht aus der Verleihung einer Organstellung, sondern seien Ergebnisse der Entwicklung einer rechtsstaatlichen Rechtskultur und beruhten auf dem Prinzip des "fair trial". Er sei ein subjektiv-engagiertes, parteigebundenes Organ, welches Gesellschaft und staatliche Rechtsordnung den Rechtsunterworfenen gegen die eigenen staatlichen Interessen zur Verfügung stellten und das mit allen nicht strafbaren Mitteln auch ein für ungerecht gehaltenes Gesetz bekämpfen dürfe. Der Grundsatz, daß Rechtsanwalt sein könne, wer bei seinem politischen Handeln nicht gegen Strafgesetze verstoße, erkläre sich aus den Erfahrungen im nationalsozialistischen Staat. In der freiheitlichen Demokratie sollten auch Juristen, die aus politischen Gründen im Staatsdienst untragbar seien, den freien Beruf eines Rechtsanwalts ausüben können. Dieser Grundsatz sei in großem Umfang und mit Zustimmung des Anwaltssenats des Bundesgerichtshofs zugunsten von Personen angewendet worden, die wegen ihrer Mitwirkung an nationalsozialistischen Unrechtsurteilen freiwillig aus dem Justizdienst ausgeschieden seien. | |
Die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Versagung der Zulassung laufe ebenso wie die Ausschließung eines Rechtsanwalts auf ein Berufsverbot und damit auf den schwersten Eingriff in einen grundrechtsgeschützten Bereich hinaus. Ein solcher Eingriff werde durch das gewaltfreie, teils lange zurückliegende, vom Bundesgerichtshof unzureichend und mit verfehlter Diktion gewürdigte Verhalten des Beschwerdeführers nicht gerechtfertigt; bei vorurteilsloser Betrachtung könne von Unwürdigkeit keine Rede sein. Es sei verfehlt, die Unwürdigkeitsklausel mit politischem Inhalt in dem Sinne auszufüllen, daß eine den jeweiligen Inhabern der Staatsgewalt unbequeme politische Gesinnung maßgebend für die Nichtzulassung zum Beruf sein solle. Das sei schon mit dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG unvereinbar, das der Bundesgerichtshof offenbar übersehen habe.
| |
Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig und begründet. | |
Maßstab für die verfassungsrechtliche Überprüfung der angegriffenen Entscheidung ist das Grundrecht der Berufsfreiheit. Soweit aus Art. 33 Abs. 5 GG Grundsätze zur politischen Treuepflicht von staatlichen Bediensteten hergeleitet werden (vgl. BVerfGE 39, 334 und 46, 43), sind diese für Rechtsanwälte unanwendbar.
| |
1. Das Bundesverfassungsgericht hat normative Regelungen über den Anwaltsberuf sowie deren Anwendung bislang stets an Art. 12 Abs. 1 GG gemessen, der die berufliche Freiheit als besonderes Grundrecht schützt. Das gilt nicht nur für Regelungen über die Ausübung dieses Berufs und das anwaltliche Standesrecht (vgl. BVerfGE 15, 226; 16, 214; 22, 114 und 34, 293 zum Verteidigerausschluß; 36, 212 – Master of Law; 37, 67 – geschäftsunfähiger Anwalt; 38, 105 – Vertretung von Zeugen; 39, 156 – Ergänzungsgesetz; 39, 238 – Entpflichtung eines Verteidigers; 48, 300 – Vertretungsverbot; 50, 16 – Mißbilligung; 54, 251 – Berufsvormund; 57, 121 – Fachanwalt); vielmehr greift Art. 12 Abs. 1 GG erst recht ein, wenn durch Vorschriften über Ausschließung und vorläufiges Berufsverbot (vgl. BVerfGE 44, 105; 48, 292) oder über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft die Freiheit der Berufswahl beschränkt wird.
| |
In mehreren dieser Entscheidungen haben beide Senate des Bundesverfassungsgerichts bereits die fundamentale objektive Bedeutung der seit einem Jahrhundert durchgesetzten "freien Advokatur" hervorgehoben (BVerfGE 15, 226 [234]; 22, 114 [122]; 34, 293 [302]; 37, 67 [78]; 50, 16 [29]). Dieses Postulat, das auf eine im Jahre 1867 erschienene Schrift von R. von Gneist zurückgeht, kennzeichnet die Umwandlung der staatsdienerähnlichen Ausgestaltung des Advokatenstandes in einen vom Staat unabhängigen freien Beruf (vgl. Weißler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, 1905, S. 572 ff.; Huffmann, Kampf um freie Advokatur, 1967; Ostler, Die deutschen Rechtsanwälte 1871–1971, 1971, S. 16 ff.). Diese Umwandlung wurde schließlich reichseinheitlich durch die Rechtsanwaltsordnung | |
Die von der Rechtsanwaltsordnung durchgesetzte und näher ausgestaltete freie Advokatur blieb im wesentlichen bis zum Ende der Weimarer Republik unverändert erhalten. Nach dem Versuch der nationalsozialistischen Machthaber, den Rechtsanspruch auf freie Zulassung durch ein Ausleseprinzip zu ersetzen und die "individualistisch" ausgerichtete Rechtsanwaltschaft in ein Organ der nationalsozialistisch verstandenen Rechtspflege mit beamtenähnlichen Treuepflichten umzugestalten (vgl. etwa Hanssen, DR 1944, S. 353; EGHfRA XXIX [1935], 88), kehrte der Gesetzgeber nach Ende des Krieges in den Ländern und später im Bund wieder zum Grundsatz der freien Advokatur zurück. Die Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. August 1959 stellt ausdrücklich klar, daß der Rechtsanwalt einen freien Beruf ausübt, daß er zum unabhängigen Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten berufen ist (§§ 2 f.) und daß die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nur aus den im Gesetz bezeichneten Gründen versagt werden darf (§ 6).
| |
2. Die Herauslösung des Anwaltsberufs aus beamtenähnlichen Bindungen und seine Anerkennung als ein vom Staat | |
Das Ausgangsverfahren gibt im übrigen keinen Anlaß zu der Prüfung, welche öffentlich-rechtlichen Bindungen der Gesetzgeber der Anwaltschaft innerhalb der Grenzen des Art. 12 Abs. 1 GG auferlegen dürfte. Jedenfalls läßt sich schon aus dem geltenden Recht nichts dafür herleiten, daß der freie und durch das Grundrecht der Berufsfreiheit geschützte Anwaltsberuf entgegen der rechtsstaatlichen Tradition der freien Advokatur an die Staatsorganisation herangeführt, beamtenähnlichen Treuepflichten unterworfen oder berufsrechtlich der Stellung von Richtern und Staatsanwälten angeglichen werden sollte. Ebenso wie bei anderen freiberuflichen Tätigkeiten (vgl. dazu BVerfGE 39, 334 [373]) wäre es auch im Anwaltsrecht nicht statthaft, unter Einschränkung der Freiheitsgarantie des Art. 12 Abs. 1 GG die für staatliche Bedienstete aus Art. 33 Abs. 5 GG hergeleiteten Grundsätze in irgendeiner Weise anzuwenden. Der deutlichen Unterscheidung zwischen Rechtsanwälten einerseits und Richtern und Staatsanwälten andererseits hat im übrigen auch der Bundesgerichtshof in seiner ehrengerichtlichen Rechtsprechung Rechnung getragen und demgemäß die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft solchen Bewerbern nicht versagt, die sich nach der Sonderregelung für Richter und Staatsanwälte in § 116 DRiG vorzeitig hatten in den Ruhestand versetzen lassen (BGHZ 40, 191 [193]). Auch in der angegriffenen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof im Grundsatz ausdrücklich daran festgehalten, daß bei einem Anwaltsbewerber die persönliche und politische Einstellung | |
II.
| |
Mit dem sonach maßgeblichen Grundrecht der Berufsfreiheit ist der in der Bundesrechtsanwaltsordnung vorgesehene und in der angegriffenen Entscheidung angewandte Versagungsgrund der Unwürdigkeit vereinbar. Der Bewerber wird aber in seinem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt, wenn § 7 Nr. 5 BRAO dahin ausgelegt wird, im Rahmen der Gesamtwürdigung dürfe ein aktives Eintreten für eine verfassungsfeindliche Partei auch dann nachteilig mitberücksichtigt werden, wenn es nicht den Tatbestand des strafbaren Bekämpfens der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (§ 7 Nr. 6 BRAO) erfülle.
| |
1. Die Versagung der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bedeutet für den Betroffenen, daß er den Beruf nicht ergreifen darf, den er als Grundlage seiner Lebensführung anstrebt, für den er sich ausgebildet hat und für den er die fachlichen Voraussetzungen mitbringt. Sein Grundrecht auf freie Berufswahl wird daher in schwerwiegender Weise eingeschränkt.
| |
Solche Einschränkungen sind nach ständiger Rechtsprechung nur unter strengen Voraussetzungen zum Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter und unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit statthaft (BVerfGE 7, 377 [405 f.]; 25, 1 [11]; 44, 105 [117]; 59, 302 [315 f.]). Diese Rechtsprechung geht von einer aus Art. 12 Abs. 1 GG folgenden grundsätzlichen Freiheitsvermutung aus (vgl. BVerfGE 13, 97 [105]). Sie ist an dem Grundgedanken orientiert, daß dem Grundrecht der Berufsfreiheit ein besonderer Rang zukommt, der in dem engen Zusammenhang mit der freien Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit im ganzen begründet ist (BVerfGE 19, 330 [336 f.]). Dieser freien Persönlichkeit, die nach der Ordnung des Grundgesetzes der oberste Rechtswert ist, muß auch bei der Berufswahl die größt | |
Mit dem Bundesgerichtshof (vgl. BGHZ 68, 46 [47 f.]) kann davon ausgegangen werden, daß die Bundesrechtsanwaltsordnung diesen Anforderungen genügt, wenn sie in der für das Ausgangsverfahren maßgeblichen Vorschrift des § 7 Nr. 5 die Zulassung zur Anwaltschaft davon abhängig macht, daß sich der Bewerber nicht "eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das ihn unwürdig erscheinen läßt, den Beruf eines Rechtsanwalts auszuüben". Eine entsprechende Regelung war bereits im ersten Regierungsentwurf einer Bundesrechtsanwaltsordnung aus dem Jahre 1952 (BRDrucks. 258/52) enthalten und während des langjährigen Gesetzgebungsverfahrens nicht umstritten. Sie knüpfte an § 5 Nr. 5 der Rechtsanwaltsordnung von 1878 an, wonach die Zulassung zu versagen war, wenn der Bewerber nach dem Gutachten des Vorstands der Anwaltskammer sich eines Verhaltens schuldig gemacht hatte, das die Ausschließung von der Rechtsanwaltschaft bedingen würde. Demgegenüber verzichtet die Neuregelung auf die Fiktion eines Disziplinarverfahrens gegen einen Nichtanwalt, die in der Praxis zu Schwierigkeiten und Härten geführt hatte (vgl. Anlage zur BRDrucks. 258/52, S. 18 f.). In seiner jetzigen Fassung läßt sich der Versagungsgrund der Unwürdigkeit als subjektive Zulassungsvoraussetzung mit der hohen Bedeutung der Rechtsanwaltschaft für die Rechtspflege und der danm verbundenen herausgehobenen Stellung rechtfertigen. Daß der Tatbestand generalklauselartig durch einen wertungsabhängigen Begriff umschrieben wird, ist verfassungsrechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden (vgl. BVerfGE 26, 186 [204]; 36, 212 [219]); den damit verbundenen Problemen hat der Gesetzgeber durch eine besondere Verfahrensgestaltung für die Feststellung dieses Versagungsgrundes zu begegnen versucht (vgl. BVerfGE 44, 105 [116] m.w.N.). Schließlich sind auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit keine durch | |
2. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG verlangt, daß Einschränkungen der Berufsfreiheit auf gesetzlicher Grundlage beruhen. Dieses Erfordernis folgt nach ständiger Rechtsprechung daraus, daß die folgenschwere Abwägung, gegenüber welchen Gemeinschaftsinteressen und wie weit das hochrangige Grundrecht der Berufsfreiheit zurücktreten muß, in den Verantwortungsbereich des Gesetzgebers fällt (BVerfGE 41, 251 [263 f.] m. w. N.). Die berufsrechtlichen Regelungen der Bundesrechtsanwaltsordnung stehen im Spannungsverhältnis zweier verfassungsrechtlich relevanter Grundsätze, einerseits des bereits erörterten Grundsatzes der freien Advokatur und andererseits des Allgemeininteresses an einer funktionstüchtigen Rechtspflege. Dieses Spannungsverhältnis im Sinne eines angemessenen Ausgleichs innerhalb der von der Verfassung gesetzten Grenzen zu lösen, obliegt der Entscheidung des Gesetzgebers. Deshalb ist es unerläßlich, unter Anwendung anerkannter Auslegungsregeln sorgfältig zu prüfen, welche Entscheidungen der | |
Diesen Anforderungen wird die Auslegung der Zulassungsvorschriften durch den Bundesgerichtshof nicht hinreichend gerecht. Nach seiner Meinung soll der Versagungsgrund der Unwürdigkeit (§ 7 Nr. 5 BRAO) nicht dadurch eingeschränkt werden, daß gemäß § 7 Nr. 6 ein Zulassungsantrag nur dann wegen Bekämpfens der freiheitlichen demokratischen Grundordnung abgelehnt werden darf, wenn dies in strafbarer Weise erfolgt. Beide Normen bildeten zwei voneinander unabhängige Versagungsgründe, wobei der zweite ein strafbares Verhalten voraussetze (BGHZ 68, 46 [48]; so wohl auch Isele, BRAO, 1976, S. 44 f.). In der angegriffenen Entscheidung wird die Mitberücksichtigung eines nicht strafbaren Kampfes gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ergänzend damit gerechtfertigt, die Prüfung der Unwürdigkeit erfordere eine Würdigung der Gesamtpersönlichkeit des Bewerbers, von der sich seine politische Auffassung jedenfalls dann nicht trennen lasse, wenn sie nach außen durch aktive Unterstützung einer verfassungsfeindlichen Partei hervorgetreten sei (BGHZ 77, 331 [333, 336 f.]).
| |
Unter der Herrschaft der Rechtsanwaltsordnung von 1878 war die politische Unabhängigkeit des Anwalts und damit die Freiheit des politischen Bekenntnisses und der politischen Bindung – soweit ersichtlich – nirgends ernsthaft angetastet oder gar als unvereinbar mit den Aufgaben der Rechtsanwaltschaft angesehen worden; Freiheit der politischen Betätigung galt vielmehr als Bedingung für die Unabhängigkeit des Standes schlechthin (Brandi, Von der Freiheit der Advokatur, in Anwälte zur Reform des Strafrechts und Standesrechts, Gedenkschrift für Cüppers, 1955, S. 13 [22]). Nach der standesgerichtlichen Rechtsprechung hatte die politische Stellungnahme des Betroffenen bei der Beurteilung vollkommen außer Betracht zu bleiben, weil es dem Rechtsanwalt unverwehrt sei, seiner politischen Anschauung freien Ausdruck zu geben, solange die Art ihrer Betätigung nicht die Grenzen überschreite, welche ihm die allgemeinen Gesetze oder die Pflichten des Standes zögen (EGHfRA XII [1905], 43 [48]; vgl. ferner EGHfRA VI [1892], 241 [244 f.] – aktive Betätigung der Zugehörigkeit zur SPD; XIV [1908], 81 – Liebknecht).
| |
Auch der erste Entwurf für eine Bundesrechtsanwaltsordnung (BRDrucks. 258/52) enthielt noch keine Vorschriften über politische Verhaltenspflichten. Der Vorschlag des Bundesrats, die Zulassung außer bei Unwürdigkeit auch dann zu versagen, "wenn der Bewerber sich so verhalten hat, daß die Besorgnis begründet ist, er werde als Rechtsanwalt die verfassungsmäßige Ordnung oder die Belange der Rechtsuchenden gefährden" (Anl. 3 zu BTDrucks. I/3650, S. 2), blieb noch im Regierungsentwurf für die zweite Wahlperiode (BRDrucks. 325/54) unberücksichtigt. Ursächlich dürfte dafür gewesen sein, daß die als "politische Klausel" bezeichnete Zulassungsbeschränkung schon im Jahre 1952 von der Arbeitsgemeinschaft der Anwaltskammervorstände und dem Deutschen Anwaltverein in einer gemeinsamen Stellungnahme als untragbar | |
Für die dritte Lesung im Bundestag hatte die strittige Klausel die Fassung erhalten, die Zulassung sei zu versagen, "wenn der Bewerber die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft" (vgl. Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses, BTDrucks. III/778, S. 3). Gleichwohl verstummte der Wider | |
b) Die Auslegung des Bundesgerichtshofs wird von der übrigen Rechtsprechung und in der Literatur nicht geteilt.
| |
Nach Ansicht des Ehrengerichtshofs Stuttgart (AnwBl. 1971, S. 120; ähnlich wohl auch Kalsbach, BRAO, 1960, Rdnr. 8 zu § 7) folgt aus der Gesetzessystematik, daß eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Einstellung, selbst wenn darin ein Bekämpfen zu sehen wäre, nicht zur Versagung der Zulassung wegen Unwürdigkeit führen dürfe, solange sie nicht in strafbarer Weise durchgesetzt werde; anderenfalls sei die Vorschrift des § 7 Nr. 6 BRAO überflüssig.
| |
Zum gleichen Ergebnis gelangen Ostler (Zum Erfordernis der Verfassungstreue des Rechtsanwalts, BayVBl. 1978, S. 527), Zuck (NJW 1979, S. 1121 [1123]) und Stern (Anwaltschaft und Verfassungsstaat, 1980, S. 17). Ostler unterscheidet streng zwischen der Verfassungstreue der Richter und den Pflichten der freien Anwaltschaft und hält ein Bekämpfen der freiheit | |
c) Die durch Art. 12 Abs. 1 GG gebotene Prüfung, in welchem Ausmaß der Gesetzgeber den Zugang zum freien Anwaltsberuf eingeschränkt hat, nötigt in Übereinstimmung mit den zuvor genannten Auffassungen zu einer engeren Auslegung, als sie der Bundesgerichtshof in der angegriffenen Entscheidung vertritt. Diese läßt sich weder mit der Entstehungsgeschichte noch mit der Gesetzessystematik vereinbaren. Sie steht mit der gesetzgeberischen Abwägung zwischen den Gemeinschaftsinteressen und dem Grundrecht der Berufsfreiheit nicht in Einklang und beschränkt dieses daher über das vom Gesetzgeber vorgesehene Ausmaß hinaus.
| |
Die Entstehungsgeschichte läßt erkennen, daß sich der Ge | |
d) Dieser Beurteilung stehen andere Vorschriften der Bundesrechtsanwaltsordnung nicht entgegen. Aus der bereits erörterten Einstufung der Rechtsanwaltschaft als Organ der Rechtspflege läßt sich keine weitergehende Einschränkung der freien Berufswahl herleiten als aus den speziellen Vorschriften über die Zulassung. Das gleiche gilt für die Vorschrift des § 26 BRAO, wonach der Anwalt nach seiner Zulassung eidlich zu bekräftigen hat, er werde die verfassungsmäßige Ordnung wahren und die Pflichten eines Rechtsanwalts erfüllen.
| |
Die Eidespflicht war im Entwurf der Bundesrechtsanwaltsordnung mit der Überlieferung (BRDrucks. 461/57, S. 67 f.) und während der Gesetzesberatungen mit den Gepflogenheiten in anderen Staaten (15. Sitzung des Rechtsausschusses vom 27. März 1958, StenProt. S. 8) begründet worden. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, aus einem promissorischen Gelöbnis dürften keine zusätzlichen Loyalitätspflichten hergeleitet werden, die über die in anderen Vorschriften und im | |
Das Ausgangsverfahren nötigt nicht zu einer abschließenden Prüfung, welche Bedeutung die Eidesformel für die Pflichten eines zugelassenen Rechtsanwalts haben könnte. Abgesehen davon, daß der Beschwerdeführer nach den Feststellungen des Ehrengerichtshofs zur Eidesleistung bereit ist, läßt sich jedenfalls im Zulassungsverfahren die Würdigkeit eines Bewerbers, der den eidlich bekräftigten Berufspflichten noch nicht untersteht, nicht prognostisch am Inhalt der Eidesformel messen. Dem steht auch entgegen, daß das Gesetz Rechtsfolgen in Gestalt einer Rücknahme der Zulassung ausschließlich an die Verweigerung des Eides knüpft (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 und § 14 Abs. 1 Nr. 7 BRAO).
| |
III.
| |
Für die Auffassung des Bundesgerichtshofs, bei der Entscheidung über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft dürfe ein aktives Eintreten für eine verfassungsfeindliche Partei auch dann nachteilig mitberücksichtigt werden, wenn es nicht den Tatbestand des strafbaren Bekämpfens der freiheitlichen demokratischen Grundordnung erfülle, fehlt nach alledem die nach | |
Der Bundesgerichtshof würdigt ausführlich das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Fehlverhalten und erblickt darin eine rechtsfeindliche Einstellung. Der Beschwerdeführer beanstandet diese Würdigung als unzureichend und unzutreffend. Darauf ist aber schon deshalb nicht näher einzugehen, weil es sich bei dieser Würdigung um eine den zuständigen Gerichten obliegende und verfassungsgerichtlich nur begrenzt nachprüfbare Beurteilung eines konkreten Sachverhalts handelt (vgl. BVerfGE 18, 85 [92 ff.]).
| |
Die angegriffene Entscheidung läßt nicht erkennen, ob der Bundesgerichtshof entgegen der Ansicht des Ehrengerichtshofs meint, die konkreten Vorwürfe reichten bereits für sich allein aus, dem Beschwerdeführer die Zulassung wegen Unwürdigkeit zu versagen. Jedenfalls begnügt der Bundesgerichtshof sich nicht mit einer Beurteilung der im Verfahren geltend gemachten konkreten Vorwürfe, sondern berücksichtigt bei der Gesamtwürdigung das aktive Eintreten des Beschwerdeführers für den KBW und seine Kandidatur für diese Partei bei den Kommunalwahlen. Damit geht er bei der Auslegung des Versagungsgrundes des § 7 Nr. 5 BRAO, der allein Gegenstand des ehrengerichtlichen Verfahrens war, über die vom Gesetzgeber getroffene Regelung hinaus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Bundesgerichtshof ohne diesen Auslegungsfehler zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre. Hätte dem Bundesgerichtshof das konkrete Verhalten des Beschwerdeführers und die daraus erkennbare Einstellung genügt, so hätte er kaum die aktive Mitgliedschaft im KBW als "gewichtiges Beweisanzeichen" für die rechtsfeindliche Gesinnung des Beschwerdeführers herangezogen und insoweit dem Ehrengericht ausdrücklich eine Verkennung der Rechtslage zur Last gelegt. Daß er diese Mitgliedschaft als erheblich für die Entscheidung | |
Die Entscheidung über die Erstattung der notwendigen Auslagen beruht auf § 34 Abs. 4 BVerfGG.
| |
(gez.) Dr. Benda Der Richter Dr. Böhmer ist an der Unterschrift verhindert. Dr. Benda Dr. Simon Dr. Faller Dr. Hesse Dr. Katzenstein Dr. Niemeyer Dr. Heußner
| |
Ich stimme der Senatsentscheidung im Ergebnis und auch darin zu, daß der angegriffene Beschluß bereits deshalb aufzuheben ist, weil der Bundesgerichtshof das Grundrecht der anwaltlichen Berufsfreiheit über das vom Gesetzgeber vorgesehene Ausmaß hinaus eingeschränkt hat. Dieser "formalrechtlichen" Begründung könnte entgegengehalten werden, sie hänge weitgehend von einer den Fachgerichten obliegenden Auslegung des einfachen Gesetzesrechts ab. Daher halte ich die in der Entscheidung offengebliebene ergänzende Prüfung für erforderlich, ob der angegriffene Beschluß zugleich aus spezifischen Gründen des materiellen Verfassungsrechts zu beanstanden ist. Diese Frage ist zu bejahen. Einschränkungen der anwaltlichen Berufsfreiheit, welche über die derzeitige Zulassungsregelung mit dem in der Senatsentscheidung klargestellten Inhalt hinausgehen (dazu unten I), sind unvereinbar mit den inhaltlichen Anforderungen des Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG (dazu unten II) und überschreiten die durch Art. 18 und Art. 21 Abs. 2 GG gezogenen Grenzen (dazu unten III); eine abweichende ver | |
I.
| |
Nach geltendem Recht ist die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu versagen, wenn sich der Bewerber unwürdig verhalten oder die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft hat. Soweit die Befürworter einer weitergehenden Einschränkung der Berufsfreiheit auch ein nicht strafbares Bekämpfen der Grundordnung für einen Versagungs- oder einen Ausschließungsgrund halten, stellt der Deutsche Anwaltverein mit Recht die Frage, welche Sachverhalte damit eigentlich gemeint sein könnten. Der Tatbestand "Bekämpfen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung" scheint zwar ein gefahrvolles und verwerfliches Verhalten zu erfassen. Die wirklich gefährlichen Erscheinungsformen dieses Verhaltens sind indessen bereits strafrechtlich verboten und fallen damit unter den Versagungsgrund des § 7 Nr. 6 BRAO; unwürdiges Verhalten führt unabhängig von seiner politischen Motivierung zur Versagung gemäß § 7 Nr. 5 und beim zugelassenen Anwalt zu ehrengerichtlichen Maßnahmen. Unter dieser Voraussetzung bleibt als "Bekämpfen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung" nur zweierlei übrig: Einmal kritische Meinungsäußerungen in Wort, Schrift und in demonstrativer Form, die weder strafbar sind noch per se den Vorwurf der Unwürdigkeit rechtfertigen, und zum anderen die Unterstützung einer als "verfassungsfeindlich" angesehenen, nicht verbotenen Partei. Das Ausgangsverfahren und noch deutlicher das ursprünglich damit verbundene Vorlageverfahren zeigen, daß in der Praxis vor allem der zuletzt genannte Vorwurf in Betracht kommt.
| |
Für die weitere Prüfung ist festzuhalten, daß sowohl kritische Meinungsäußerungen als auch die Unterstützung nicht verbotener Parteien als legal jedermann gestattet sind. Beides gehört sogar zu Verhaltensweisen, die unter besonderen Garan | |
II.
| |
1. Nach der im Senatsbeschluß zitierten Rechtsprechung darf die Freiheit der Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 GG) nur unter strengen Voraussetzungen zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter und nur unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt werden.
| |
Als schutzwürdiges wichtiges Gemeinschaftsgut kommt vorliegend das schwerwiegende Allgemeininteresse an einer funktionstüchtigen Rechtspflege in Betracht. Diesem hat aber der Gesetzgeber bereits dadurch hinreichend Genüge getan, daß durch die Zulassungsregelung solche Bewerber ausgeschlossen werden, welche die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen oder welche wegen ihres Verhaltens unwürdig sind, den Beruf eines Rechtsanwalts auszuüben. Liegen in der Person des Bewerbers diese Voraussetzungen (oder sonstige in der Bundesrechtsanwaltsordnung genannte Versagungsgründe) nicht vor, dann ist nicht erkennbar, welche Gemeinwohlinteressen es gebieten, ihm gleichwohl den Zugang zu verweigern und auf diese Weise den Grundsatz der freien Advokatur in unverhältnismäßiger Weise einzuschränken. Jedenfalls läßt sich eine Zulassungsverweigerung wegen kritischer politischer Meinungsäußerungen oder wegen Unterstützung einer nicht verbotenen Partei schwerlich mit überwiegenden Gemeinwohlbelangen rechtfertigen. Das ist auch während des Gesetzgebungsverfahrens nicht ernstlich behauptet worden. Schließlich untersteht der Bewerber nach seiner Zulassung den aus den Verfahrensordnungen und dem Berufs | |
Eine über die geltende Regelung hinausgehende Zulassungsbeschränkung wegen kritischer Meinungsäußerungen oder Unterstützung nicht verbotener Parteien könnte sich eher schädlich für das richtig verstandene Gemeinwohlinteresse auswirken. Schon bei den Gesetzesberatungen und ebenso in einigen Stellungnahmen ist darauf hingewiesen worden, in einem freiheitlichen Rechtsstaat liege es im Allgemeininteresse an richtigen und möglichst gerechten Entscheidungen, wenn auch Rechtsuchende, welche die verfassungsmäßige Ordnung ablehnen, Anwälte ihres Vertrauens auswählen könnten. Es sei geradezu kennzeichnend für einen solchen Staat, daß dem Bürger auch Rechtsanwälte zur Verfügung stünden, welche im Streit um die richtige Entscheidung keine besondere politische Loyalität schuldeten, sondern das geltende Recht und seine Anwendung durch freie Meinungsäußerungen kritisch in Frage stellten. Dies steht in Einklang mit dem Selbstverständnis der freiheitlichen Demokratie, von dem es schon im KPD-Urteil heißt (BVerfGE 5, 85 [135, 197 f.]), daß die jeweiligen Verhältnisse stets verbesserungsbedürftig, aber auch verbesserungsfähig seien, daß damit eine nie endende Aufgabe gestellt sei, die in Anpassung an die sich wandelnden politischen und sozialen Tatbestände und in ständiger geistiger Auseinandersetzung zwischen den sozialen Kräften, Interessen, politischen | |
2. Selbst wenn entgegen den vorstehenden Erwägungen unterstellt würde, Art. 12 Abs. 1 GG gestatte für sich allein eine über das derzeitige Recht hinausgehende gesetzgeberische Einschränkung der freien Berufswahl im Sinne der angegriffenen Entscheidung, wäre dabei jedenfalls das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG einzuhalten. Zumindest mit diesem Verbot ist es unvereinbar, den Zugang zum freien Anwaltsberuf wegen einer jedermann gestatteten Kritik an der verfassungsmäßigen Ordnung oder Zugehörigkeit zu einer nicht verbotenen Partei zu behindern.
| |
Gemäß Art. 3 Abs. 3 GG, auf den der Bundesgerichtshof nicht eingegangen ist, darf "niemand wegen seiner politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden". Dadurch wird der allgemeine Gleichheitssatz für einen bestimmten Lebenstatbestand zwingend konkretisiert und die politische Anschauung als Anknüpfungspunkt für eine Diskriminierung oder Privilegierung untersagt (BVerfGE 39, 334 [367 f.]). Dieses Verbot beruht auf den Erfahrungen des Dritten Reiches (vgl. Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Anmerkung I und II 3 a zu Art. 3 GG). Die Beseitigung rassischer, religiöser, politischer und geschlechtlicher Diskriminierungen gehörte sogar zu den bevorzugten Maßnahmen des Verfassungsgebers, um dem unter der Weimarer Verfassung umstrittenen Gleichheitssatz als Grundprinzip der neuen rechtsstaatlichen Demokratie wirksame Geltung zu verschaffen. Jedenfalls verdient das Diskriminierungsverbot mindestens ebenso sorgfältige Beachtung wie andere rechtserhebliche Konsequenzen aus den zurückliegenden Erfahrungen, zumal die in Art. 3 Abs. 3 GG mißbilligten Benachteiligungen nicht nur dem Wesen eines demokratischen | |
Gleichwohl führt das Diskriminierungsverbot ein merkwürdiges Schattendasein. Soweit ersichtlich ist es in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung nur vereinzelt als erheblich herangezogen worden (BVerfGE 23, 98 [107] – Ausbürgerung; vgl. BVerwGE 9, 210 [212] – Verfolgte des Nationalsozialismus). Dies mag darauf beruhen, daß für die Anwendung dieses Verbots ein kausaler Zusammenhang zwischen der besonderen Behandlung und den in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Gründen erforderlich ist (BVerfGE 59, 128 [157] m. w. N.), der häufig nicht vorliegt. Seine Tragweite mag ferner begrenzt sein, soweit andere gleichrangige verfassungsrechtliche Regelungen diese Begrenzung rechtfertigen (so BVerfGE 39, 334 [367 f.] – Radikale im öffentlichen Dienst; bedenklich und ohne zureichende Begründung BVerfGE 13, 46 [49]); allerdings können selbst solche anderen Regelungen das grundsätzliche Diskriminierungsverbot nur so weit zurückdrängen, wie das nach dem verfassungskräftigen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unerläßlich ist, so daß schon im öffentlichen Dienst eine Differenzierung nach Art der dienstlichen Obliegenheiten geboten wäre (anders BVerfGE 39, 334 [355]). Volle Geltungskraft beansprucht das Diskriminierungsverbot jedenfalls überall dort, wo die Verfassung Benachteiligungen wegen politischer Überzeugungen ihrerseits nicht abdeckt. Das gilt namentlich für die staatliche Regelung freiberuflicher Tätigkeiten. Hier finden politische Aktivitäten ihre Schranken lediglich in den für jedermann geltenden (verfassungskonformen) allgemeinen Gesetzen, durch Verwirkung von Grundrechten gemäß Art. 18 GG und als Folge von Parteiverboten gemäß Art. 21 Abs. 2 GG (vgl. BVerfGE 39, 334 [373]). | |
Diese verfassungsrechtliche Beurteilung des Diskriminierungsverbots wird erhärtet, wenn der bislang wenig beachtete Umstand berücksichtigt wird, daß die Verfassungsväter die Auf | |
III.
| |
Wird die Zulassung zu einem freien Beruf wegen Unterstützung einer nicht verbotenen Partei im Sinne der angegriffenen Entscheidung erschwert, so werden ferner die Grenzen überschritten, die sich für berufsrechtliche Beschränkungen aus dem Parteienprivileg (Art. 21 Abs. 2 GG) oder der Verwirkungsregelung (Art. 18 GG) ergeben.
| |
1. Beide Verfassungsnormen betreffen die Rechtsfolgen eines Kampfes gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und durchbrechen für diesen Fall das zuvor erörterte Diskriminierungsverbot (zu ihrem Verhältnis zueinander vgl. BVerfGE 25, 44 [55 ff.]). Beide Male ist die Entscheidung dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. Durch diese besondere Verfahrensgarantie hat das Grundgesetz dafür gesorgt, daß die folgenschweren Sanktionen nicht leichthin verhängt werden können (BVerfGE 10,118 [123]).
| |
Gemäß Art. 21 Abs. 2 GG sind Parteien verfassungswidrig, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Solange aber eine politische Partei nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten worden ist, darf sie nach ständiger Rechtsprechung an ihren politischen Aktivitäten | |
Gemäß Art. 18 GG verwirkt die dort genannten Grundrechte, wer sie zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht. Das Grundrecht der Berufsfreiheit ist in diesem als abschließend zu verstehenden Katalog nicht genannt (vgl. dazu BVerfGE 10, 118 [123]; 25, 88 [96 f.] für Fälle einer "automatischen Reflexwirkung"; vgl. auch BVerfGE 13, 46 [51]). Dies bedeutet aber, daß die der Verwirkungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts entzogenen Grundrechte auch von keiner anderen Instanz für verwirkt erklärt werden dürfen. Sowohl für die in Art. 18 genannten als auch für die dort nicht genannten Grundrechte gilt jedenfalls nach herrschender Ansicht übereinstimmend die Konsequenz, daß bei gleichem Tatbestand und gleichen oder gleichartigen Sanktionen die Entscheidung dem Bundesverfassungsgericht überlassen oder bei nicht verwirkbaren Grundrechten ausgeschlossen bleiben muß (vgl. BVerfGE 10, 118 [123]). Das Monopol des Bundesverfassungsgerichts darf nicht dadurch gegenstandslos gemacht werden, daß der Gesetzgeber – oder im Wege der Auslegung die Rechtsprechung – Tatbestände | |
Aus beiden Regelungen dürften sich keine rechtlichen Schwierigkeiten ergeben, wenn die Zulassungsvorschriften verfassungskonform in dem in der Senatsentscheidung erörterten Sinne ausgelegt werden. Die Versagungsgründe eines strafbaren Kampfes gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder des unwürdigen Verhaltens dienen der Sicherung einer geordneten Rechtspflege und benachteiligen den Bewerber nicht schon wegen seiner Tätigkeit für eine Partei. Solche Maßnahmen sind nach der Rechtsprechung mit Art. 21 GG vereinbar, da sie sich nicht gegen das darin geschützte Rechtsgut richten, sondern da bei ihnen die Sanktionen auf besonderen Tatbestandsmerkmalen beruhen (vgl. BVerfGE 47, 130 [139 f.]; 47, 198 [230 f.]). Auch nach Art. 18 GG kann es nicht unzulässig sein, entsprechende subjektive Zulassungsvoraussetzungen für den Anwaltsberuf aufzustellen.
| |
2. Sehr viel problematischer wird hingegen die Beurteilung, wenn die Zulassungsregelung mit dem Bundesgerichtshof als weitergehender Eingriffstatbestand ausgelegt wird. In dem ursprünglich mit der Verfassungsbeschwerde verbundenen Vorlageverfahren hatte bereits das Ehrengericht für den Fall eines vorläufigen oder dauernden Berufsverbots dargelegt, ein solches komme einer zeitlich begrenzten oder endgültigen Grundrechtsverwirkung gleich; es ziele darauf ab, ein bestimmtes unter Grundrechtsschutz stehendes Lebensgebiet für den Betroffenen zu sperren. Die Verhängung derartiger Sanktionen sei aber mit Art. 18 oder Art. 21 Abs. 2 GG unvereinbar, wenn sie wegen eines nicht strafbaren Kampfes gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung durch aktive Unterstützung einer Partei erfolge, solange nicht das Bundesverfassungsgericht eine Grundrechtsverwirkung oder ein Parteiverbot ausgesprochen habe. Dieser Beurteilung ist zuzustimmen, wobei für die Zulassungsversagung nichts anderes als für die Ausschließung gel | |
IV.
| |
Zu einer anderen Beurteilung nötigt nicht etwa die vielfach zitierte Grundentscheidung des Grundgesetzes für eine "streitbare Demokratie".
| |
Der Begriff der streitbaren Demokratie beruht auf der Zusammenschau mehrerer Normen des Grundgesetzes (insbesondere Art. 9 Abs. 2, 18, 20 Abs. 4, 21 Abs. 2 und 28 Abs. 3 GG). Aus ihnen wird hergeleitet, daß das Grundgesetz die neu konstituierte Demokratie nicht ungeschützt ihren Feinden auslie | |
Die aus den genannten Verfassungsartikeln hergeleitete Grundentscheidung für eine streitbare Demokratie beruht auf den bitteren Erfahrungen mit dem Schicksal der Weimarer Republik und der Überzeugung der Verfassungsväter, in einer bestimmten historischen Situation könnten die Prinzipien der Neutralität und der Toleranz des Staates nicht mehr rein verwirklicht werden (vgl. die Erwägungen im KPD-Urteil BVerfGE 5, 85 [137 ff.]). Die gegenüber anderen rechtsstaatlich-demokratischen Verfassungen vermehrte Bereitschaft, die neue Demokratie gegenüber ihren Gegnern zu stärken, dürfte im Grundsatz auf einem breiten Konsens beruhen. Im Grundsatz unbestritten dürfte ebenfalls die Berechtigung des staatlichen Gesetzgebers sein, den Zugang speziell zum Staatsdienst solchen zu verweigern, welche die rechts- und sozialstaatliche Demokratie ihrerseits ablehnen, sofern dabei durch verläßliche Verfahrensgarantien Schnüffelei vermieden wird und eine funktionale Differenzierung erfolgt, wie sie durch das Diskriminierungsverbot und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geboten ist. Die eigentliche verfassungspolitische und auch verfassungsrechtliche Problematik liegt weniger im Grundsätz | |
Objekt dieser Schutzvorkehrungen ist nicht irgendeine beliebige, sondern speziell diejenige politische Ordnung, für welche die demokratisch-rechtsstaatliche Freiheitlichkeit konstitutiv ist. Zu diesem Selbstverständnis steht der Staatsschutz von jeher in einem problematischen Spannungsverhältnis, das schon im KPD-Urteil anschaulich beschrieben (a.a.O. [134 ff.]) und auf das bereits in einem Sondervotum hingewiesen worden ist (BVerfGE 33, 78 [85 f.] – Überwachungsgesetz). Je perfekter der Schutz ist, je ungeeigneter oder übereifriger die damit betrauten Organe sind und je weiter die Maßnahmen indirekt über den Kreis der eigentlich Gemeinten hinauswirken und Duckmäusertum erzeugen, desto mehr wächst die Gefahr, daß das Schutzobjekt seinerseits verändert oder erstickt wird und die freiheitliche Demokratie an Überlegenheit und Leuchtkraft verliert (vgl. auch die Rede von Bundespräsident Heinemann, 25 Jahre Grundgesetz in: Allen Bürgern verpflichtet, 1975, S. 183 [192 f.]). Letztlich wird die streitbare Demokratie am verläßlichsten durch streitbare Demokraten geschützt sowie durch einen positiven Staatsschutz in dem Sinne, daß sich ihre mit Recht behauptete Überlegenheit überzeugend erweist. Soweit zusätzlich ein repressiver Staatsschutz erforderlich ist, darf die Situationsbezogenheit der jeweils gebotenen Maßnahmen nicht außer acht bleiben, welche die Prüfung einschließt, ob eine gestern nützliche Maßnahme nicht heute eher schädlich wirkt. Daraus ist im angelsächsischen Bereich der Grundsatz hergeleitet worden, daß repressive Staatsschutzmaßnahmen nur zur Abwehr klarer und gegenwartiger Gefahren in Betracht kommen können.
| |
Über diese mehr verfassungspolitischen Erwägungen mag man streiten. Verfassungsrechtlich bedarf es aber der Klärung, ob und inwieweit der Grundentscheidung für die streitbare Demokratie eine selbständige rechtliche Tragweite zukommt, ob also aus ihr weitergehende Maßnahmen hergeleitet werden | |
V.
| |
Die vorstehende Beurteilung bedeutet im Ergebnis nichts anderes als die Rückkehr zur historisch bewährten Normalität. Diese läßt sich für den Bereich des Anwaltsrechts dadurch kennzeichnen, daß der Rechtsanwalt – unbeschadet seiner Freiheit, das geltende Recht zu kritisieren und für seine Änderung zu streiten – selbstverständlich als Korrelat zu seinen beson | |